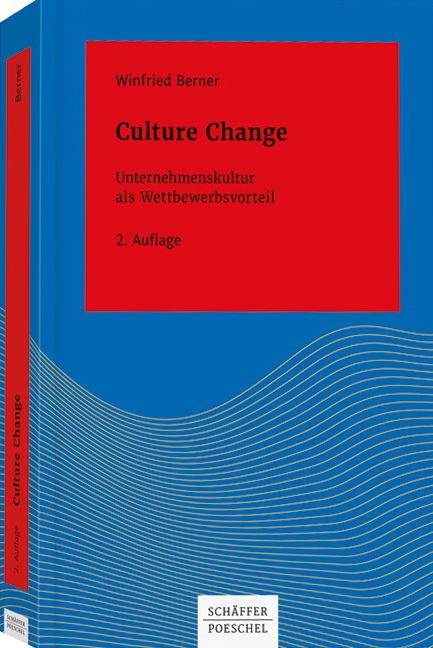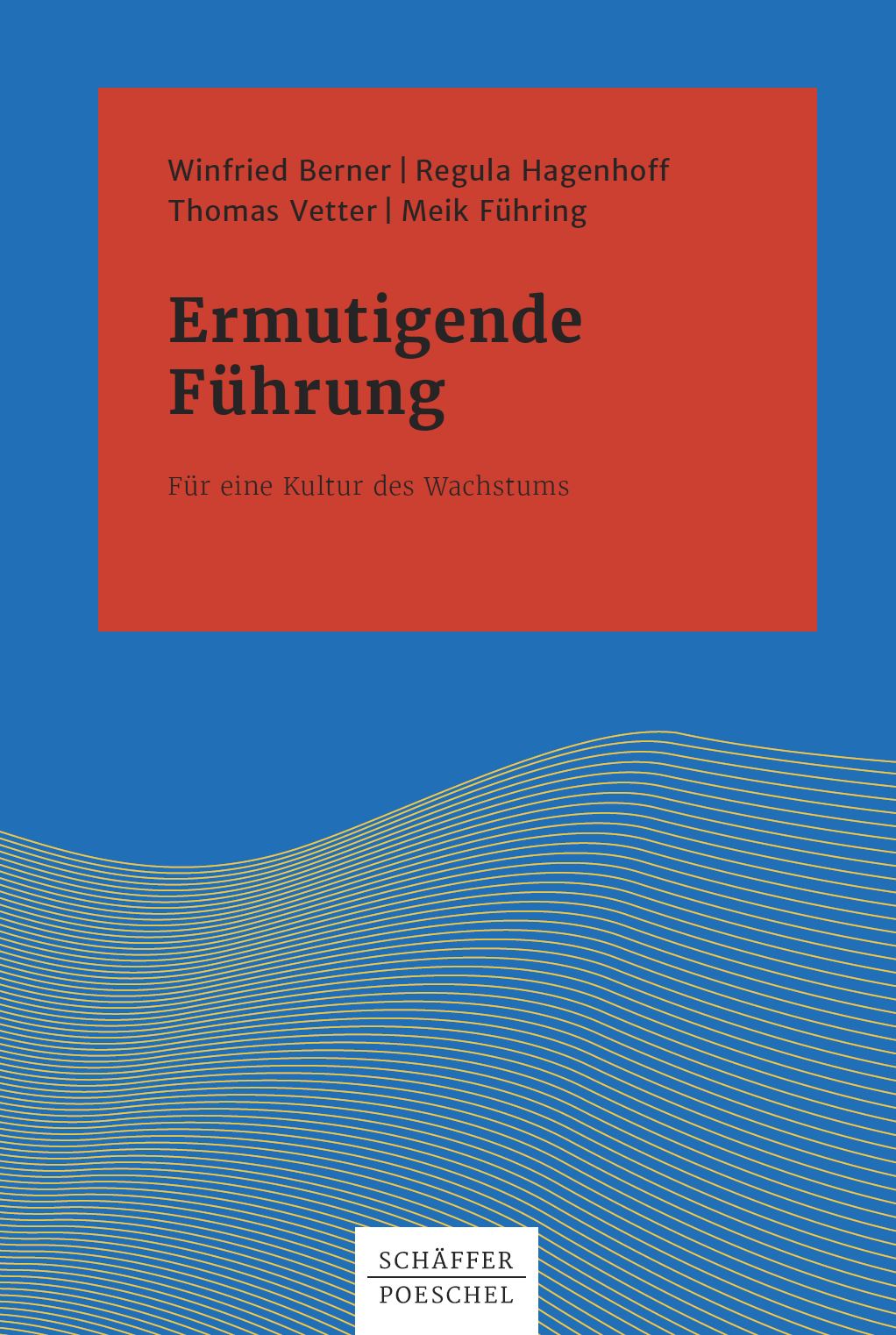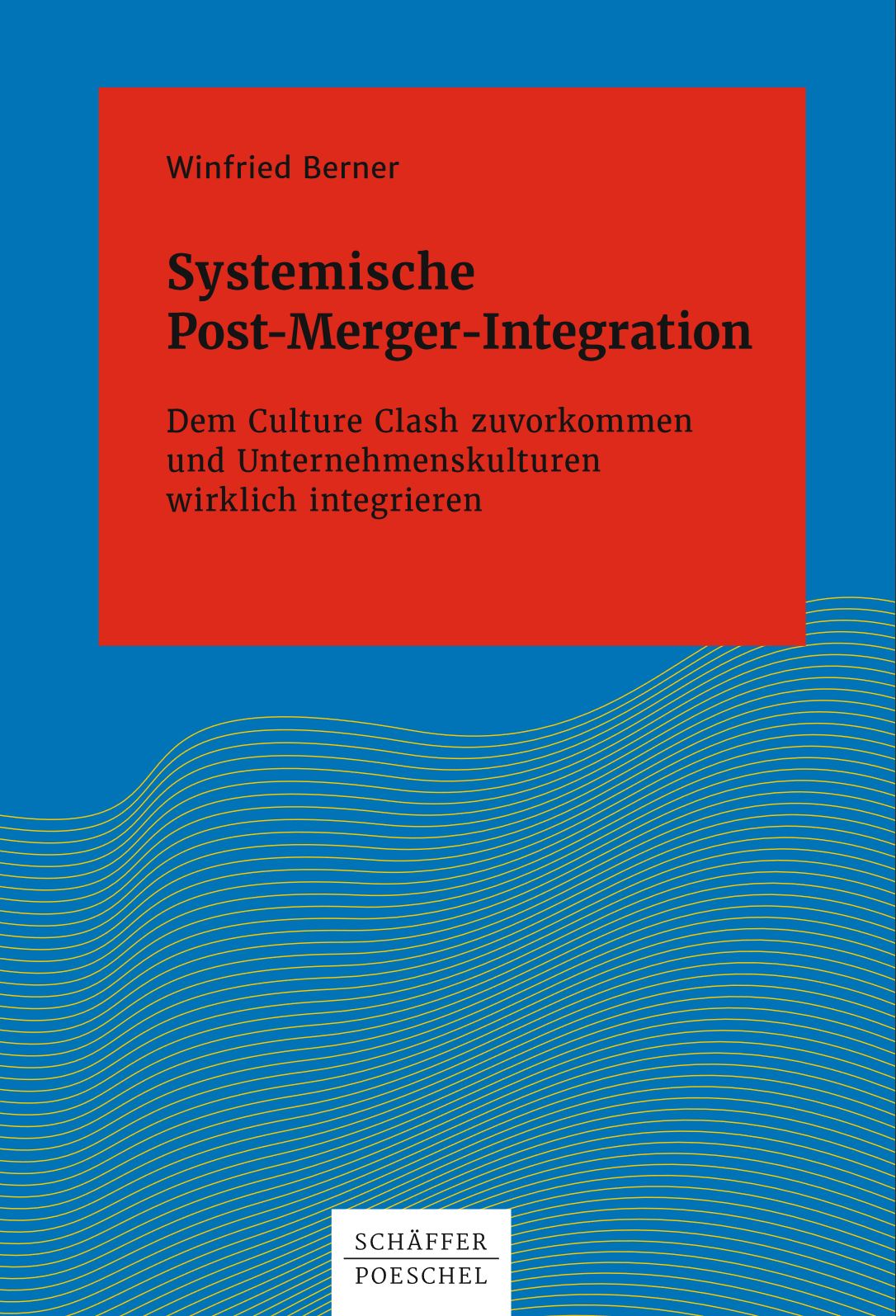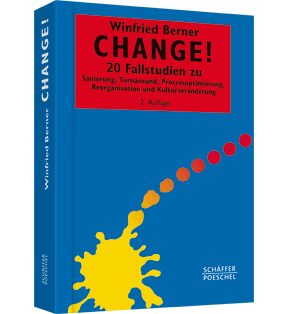Eine Veränderungsstrategie entwickeln
|
||||||||||||||||||||
Change Management 4.0: Logik und Systematik in das Chaos der Veränderungen bringen |
||
|
Es war einmal vor langer Zeit, da herrschte noch Ruhe und Kontinuität im Land, und nur selten kam es vor, dass Firmen etwas verändern mussten. Weil das dereinst so schrecklich ungewohnt war, erhob sich darob großes Wehklagen, und die weisen alten Männer, die damals noch an der Spitze der Firmen standen, riefen Psychologen zu Rate. Die führten nach geheimnisvollen Formeln ein "Unfreezing" durch, um die starren Organisationen veränderbar zu machen. Sodann formten sie die Firmen um, auf dass wieder alles gut und schön war, und nach vollbrachter Tat nahmen sie ein "Refreezing" vor. Da wurden die Firmen wieder so starr, wie sie zuvor gewesen waren, und es kehrte wieder Ruhe und Kontinuität ein. |
|
|
|
Jedenfalls erzählt man sich das so. So oder so ähnlich steht es in den Lehrbüchern der Organisationsentwicklung, also muss es so gewesen sein. Von den heute Lebenden kann sich zwar keiner mehr an jene Zeit erinnern, und bis zum heutigen Tag ist es nicht gelungen, auch nur einen einzigen Augenzeugen eines Refreezing auszumachen. Andererseits sind manche Konzerne und Behörden auch heute noch so starr, als hätte eine mächtige Zauberin sie mit einem großen Refreezing in einen Eisklotz verwandelt. Doch glauben manche Kundigen, der statische Zustand sei nicht durch Schockfrosten entstanden, sondern durch langsame Verknöcherung. |
|
|
Die Change-Projekte überschlagen und überlagern sich |
||
Die Vorstellung, dass man Unternehmen für Veränderungen eigens "auftaut", um sie nach deren Abschluss wieder in einen statischen Normalzustand zu versetzen, hat mit der heutigen Realität der meisten Mitarbeiter und Führungskräfte so wenig zu tun, dass es schon fast wieder lustig ist. Trotzdem findet sich dieses Modell nach wie vor in vielen Lehrbüchern – und zwar keineswegs in der Rubrik "Überkommene autoritär-technokratische Allmachtsphantasien", sondern mit vollem Ernst, als ob Veränderungsprozesse tatsächlich so funktionieren würden. "Auftauen"? "Wieder Einfrieren"? Wovon reden diese Leute? In welcher Welt leben sie? Haben sie sich möglicherweise im Jahrhundert geirrt? |
|
|
Für die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten jagt eine Veränderung die nächste – nicht nur aktuell, sondern seit Jahren, gefühlt mit steigendem Tempo, und es ist kein Ende abzusehen. Wenn sie sich gegen immer neue Veränderungen sperren, dann nicht, weil sie sich aus Mangel an Erfahrung vor ihnen fürchten, sondern weil es ihnen einfach zu viel wird, weil sie längst keinen Überblick mehr haben, weil ihnen schwindelig ist vor lauter Veränderung und sie Angst haben, wenn es so weiter geht, irgendwann den Halt zu verlieren. |
|
|
Groß ist daher die Sehnsucht nach einer Pause in diesem endlosen Wirbel der Veränderung oder wenigstens nach einer Verlangsamung des Tempos. Viele sehnen sich danach, einmal wieder durchatmen zu können und ein bisschen Zeit zu haben, um sich neu zu orientieren. |
|
|
Da ist es natürlich nicht sehr ermutigend, wenn an jeder Ecke Expertinnen auftauchen, die behaupten, dass in jener VUCA-Welt, auf die wir uns nach ihrer Meinung zubewegen ("Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity"), alles noch schneller und turbulenter und komplexer und noch sonstwas wird. Es hört sich beinahe so an, als empfänden sie eine diabolische Vorfreude auf den angeblich bevorstehenden Hexentanz – doch wer weiß, ob "VUCA" über das, was real in Unternehmen geschehen wird, mehr besagt als jene Legende vom magischen "Unfreezing" und "Refreezing" vor 50 oder 80 Jahren. |
|
|
Vom VUCA-VUCA-Geschrei nicht bange machen lassen |
||
Bevor wir uns einschüchtern lassen, sollten wir uns daran erinnern, dass man uns dramatische Verschärfungen des Wettbewerbs und des Veränderungsdrucks prophezeit, seit wir im Berufsleben stehen. Was hat man uns nicht schon alles vorhergesagt: den Untergang der "Deutschland AG", die "japanische Gefahr", eine dramatische Eskalation des Wettbewerbs durch den gemeinsamen europäischen Markt, mörderische Preiskonkurrenz durch die ehemaligen Ostblockstaaten, den Kollaps vieler IT-Systeme beim Datumswechsel vom 31.12.99 auf den 1.1.00, vor dem bereites eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und Tausend andere Gefahren, die ich längst wieder vergessen habe … |
|
|
Und jetzt halt "VUCA" – was soll's? Mit den Jahren reagiert man auf diese Alarmrufe, welches Drama als nächstes dräut, wie auf einen wiederkehrenden falschen Feueralarm: genervt, gelangweilt und allmählich abstumpfend. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil es irgendwann ja auch einmal wirklich brennen könnte, aber es ist die natürliche Reaktion. |
|
|
Und auch in diesem Fall ist es nützlich, die bewährte altrömische Frage zu stellen: "Cui bono – wem nützt es?" Angstmachen ist ein eine fragwürdige, aber unstrittig erfolgreiche Verkaufsstrategie. Wer uns vor schrecklichen Gefahren warnt, von denen wir bislang nichts geahnt haben, erweckt damit den Eindruck, erstens exzellent Bescheid und zweitens vielleicht auch Rettung zu wissen. Und in der Tat: Die Warner wissen Rat, den sie auch bereitwillig zu Verfügung stellen, gegen angemessene Gebühr, versteht sich, oder genauer, gegen eine der Größe der Gefahr angemessene Gebühr. |
|
|
Gegen die gelegentliche Kritik, der vorhergesagte Weltuntergang sei bislang ausgeblieben, immunisieren sie sich mit dem Verweis auf das Präventionsparadox: Gewiss, die große Katastrophe sei ausgeblieben – aber nur, weil sie so nachdrücklich davor gewarnt, die Öffentlichkeit uneigennützig informiert und ihre Kunden unermüdlich bei der Rettung unterstützt hätten. Nur dank ihrer unermüdlichen Bemühungen konnte die Katastrophe gerade noch einmal abgewendet werden. Aber Vorsicht: Die nächste lauert bereits um die Ecke! |
|
|
Markt und Wettbewerb diktieren das Tempo |
||
Andererseits wäre Entwarnung auch fehl am Platz: Die Zahl und der Umfang der Veränderungen, die ein Unternehmen realisieren muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben, richten sich nicht nach dem, was Mitarbeitern, Führungskräften und Betriebsräten zumutbar erscheint. Sie wird von Markt und Wettbewerb diktiert – unbarmherzig und ohne Rücksicht auf die Work-Life-Balance der Betroffenen. Selbst die oder der Vorstandsvorsitzende hat hier weit weniger Entscheidungsspielraum als weiter unten in der Hierarchie viele glauben. "Ein Unternehmen ist genau dann überlebensfähig, wenn seine Lerngeschwindigkeit höher ist als die Veränderungsgeschwindigkeit seiner Umgebung." So hat Michael Löhner die Sache auf den Punkt gebracht. Friss oder stirb. |
|
|
In diesem Zusammenhang wird gern und etwas gedankenlos die Geschichte von der roten Königin aus "Alice im Wunderland" zitiert, nach der man unablässig mit höchster Geschwindigkeit rennen muss, um auf der Stelle zu bleiben. Ermutigend ist das nicht, im Gegenteil: Als Motivationsquelle ist diese Metapher absolut ungeeignet, denn es liegt auf der Hand, dass das nicht gutgehen kann: Niemand kann Marathon-Sprinten. Früher oder später wird er atemlos und erschöpft zusammenbrechen. Angesichts des absehbaren und unausweichlichen Zusammenbruchs stellt sich sogar für jeden halbwegs intelligenten Menschen die Frage, weshalb er überhaupt weiterrennen soll – ob er nicht klüger wäre, sofort stehenzubleiben. |
|
|
Sofern man sie richtig liest, hat die deprimierende Geschichte von der roten Königin dennoch eine Lehre: Sie macht sichtbar, wie es auf keinen Fall funktionieren kann. Rennen bis zum Zusammenbruch ist ganz offensichtlich keine taugliche Strategie. Oder nur dann, wenn man sich sicher sein kann, dass man unter allen Konkurrenten der beste Langstreckenläufer ist. Die wirkliche Lehre der roten Königin lautet daher: Wir müssen mit der Wettbewerbssituation grundlegend anders und vor allem intelligenter umgehen als durch ständiges Rennen mit Höchstgeschwindigkeit. |
|
|
Nicht schneller rennen, schneller lernen |
||
Auch ein Wettbewerb des Lernens und der Ideen ist natürlich ein Wettbewerb – aber es ist einer, der weit weniger als ein Wettrennen (oder Wettlernen) durch natürliche Leistungs- und Erschöpfungsgrenzen limitiert ist. Mit gescheiten Ideen, einer klaren Logik und einem cleveren Vorgehen lässt sich wesentlich mehr erreichen als mit Rennen bis zum Kollaps. Ein Wettbewerb der Ideen und Strategien ist keine Frage der bloßen Anstrengung und Verausgabung, er ist eine Frage der gemeinsamen Kreativität – und damit letztlich die eines ermutigenden und zugleich fordernden Teamklimas. |
|
|
Es ist keineswegs so, dass man gegen die Beschleunigung nichts machen kann und mit dem Wasserfall der Veränderungen daher einfach irgendwie zurechtkommen muss, auch wenn er einem zunehmend den Atem nimmt und die Betroffenen mit wachsender Verzweiflung nach Luft schnappen lässt. Wenn sich schon das Tempo der Veränderungen nicht reduzieren lässt, so ist ein wichtiger erster Schritt, Klarheit, Logik und Ordnung in den überwältigenden und unvorhersehbaren Sturzbach zu bringen. |
|
|
Das ist mehr als es auf den ersten Blick scheint. Denn für die Mitarbeiter und Führungskräfte der mittleren und unteren Ebenen ist die schiere Menge der Veränderungen gar nicht das einzige Problem. Beinahe noch schlimmer ist sind für sie drei andere Punkte: Erstens, dass sie keine Logik in der Veränderungsflut erkennen, zweitens dass sie das Gefühl haben, "die da oben" würden überhaupt nicht wahrnehmen, wie sie gegen das Ertrinken kämpfen, sondern die Schleusen immer noch weiter öffnen, und drittens, dass für sie nicht vorhersehbar ist, welche Change-Vorhaben als nächste über sie hereinbrechen werden. Das zermürbt und lässt zusehends die Hoffnung schwinden, der Entwicklung auf die Dauer gewachsen zu sein. Die Angst vor dem Burnout steht im Raum. |
|
|
Weshalb die Change-Kommunikation weitgehend verpufft |
||
Die Unberechenbarkeit der anrollenden Veränderungswellen ist wenigstens zum Teil ein Kommunikations-, genauer, ein Vermittlungsproblem. Für den Vorstand und das Top-Management hat es in der Regel noch eine halbwegs klare Logik, warum gerade jetzt welche Veränderungen angegangen werden müssen und vor allem, wie sie zusammenhängen. Doch diese Logik kommt weiter unten im "Maschinenraum" der Organisation nicht an, ja, sie erreicht meist nicht einmal die mittleren Ebenen. Und zwar in der Regel deswegen nicht, weil sie erstens nicht oder zu wenig erklärt wird, und zweitens, weil sich die mittleren Ebenen nicht ausreichend damit auseinandersetzen und ihr Verständnis weitertragen. |
|
|
Zwar hat das Top-Management in den meisten Firmen inzwischen verstanden, dass erfolgreiches Change Management nicht zuletzt von Kommunikation lebt. Deshalb wird heute fast jedes Veränderungsvorhaben angekündigt und erklärt, seine Notwendigkeit wird begründet, und es werden die Ziele genannt und die grobe Vorgehensweise beschrieben. Im Vergleich zu früheren Zeiten, in denen man drohende Veränderungen allenfalls aus der gehäuften Anwesenheit von Beratern erschließen konnte, ist die Kommunikation in vielen Fällen geradezu vorbildlich. Jedenfalls werden heutzutage viele Dinge richtig oder zumindest ordentlich gemacht, die in der Vergangenheit oft versäumt bzw. für überflüssig gehalten wurden. |
|
|
Was aber meistens zu wenig oder gar nicht erklärt wird, ist, wie die einzelnen Change-Projekte zusammenhängen, was die übergeordnete Logik ist und wie das übergreifende Ressourcen-Management funktionieren soll, sprich, wie verhindert wird, dass einzelne Personen oder Bereiche von der Menge der zur gleichen Zeit stattfindenden Veränderungen überlastet und "versenkt" werden. Noch weniger wird meist erklärt, wie die Geschichte weitergehen wird, sprich, welche weiteren Change-Vorhaben in absehbarer Zeit auf die Belegschaft zukommen. Teils steht dahinter die Annahme, dafür sei es noch zu früh, zuweilen sogar der ängstliche Gedanke: "Wir wollen die Leute nicht noch mehr verschrecken." |
|
|
Das ist fatal, denn es konterkariert den Nutzen der verbesserten Change-Kommunikation und führt zu einem Abstumpfungseffekt. Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass jedes neue Veränderungsvorhaben erklärt und in seiner Notwendigkeit begründet wird. Auch wenn die Sprache zuweilen nach Bullshit-Bingo klingt, hören sich die Erklärungen doch in aller Regel so plausibel an, sodass man ihnen kaum widersprechen und gegen ihre Notwendigkeit andiskutieren kann. Aber das ändert nichts daran, dass sie trotzdem unvorhersehbar über einen hereinbrechen wie immer neue Sturzfluten. Und dass man letztlich keinen Einfluss darauf hat. Also reagieren die Leute fatalistisch. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die nächste Welle anrollt, und hören ansonsten kaum mehr hin. Die Folge: Die gut gemeinte Change-Kommunikation verpufft. |
|
|
Die Change-Logik vermitteln |
||
Die Lösung kann natürlich nicht darin liegen, die Change-Kommunikation einzustellen, weil sie eh keinen erkennbaren Nutzen (mehr) hat. Auch wenn ihr Nutzen nicht mehr sehr groß ist, hätte ihr Unterlassen negative Folgen. Denn es ist trotzdem ein Unterschied, ob das Management zumindest den Versuch macht, seine Entscheidungen zu erklären, auch wenn der nur eingeschränkt erfolgreich ist, oder ob es in die kommunikationslose alte Welt zurückkehrt. Andererseits bringt es auch nicht viel, trotz der verpuffenden Wirkung einfach so weiterzumachen wie bisher. |
|
|
Die Lösung liegt darin, nicht mehr nur das einzelne Vorhaben zu erklären, sondern auch und vor allem die übergeordnete Logik: Wie hängt das alles zusammen, was wir tun, was ist der übergeordnete Plan dahinter? Wie ordnet sich das aktuelle Vorhaben ein? Warum gerade jetzt gerade diese Veränderung? Warum kann das neue Projekt nicht noch warten, bis die vorangegangenen abgeschlossen und halbwegs verdaut sind? Und was kommt als Nächstes, worauf müssen wir uns gefasst machen, und wie geht es danach weiter? Aber auch: Wie sollen wir das alles auf die Reihe bekommen, ohne dass das Tagesgeschäft Schaden nimmt? |
|
|
Klar, der Vorstand und das Top-Management sind auch keine Hellseher: Sie wissen auch nur begrenzt, was die Zukunft bringt und auf welche Entwicklungen von Markt und Wettbewerb sie künftig reagieren müssen. Das darf man auch so sagen – die wenigsten Mitarbeiter und Führungskräfte wird ein solches Eingeständnis schwer traumatisieren, die meisten werden es verstehen. Auch wenn der kindliche Glaube kaum auszurotten ist, der Vorstand wisse (fast) alles und habe einen fertigen Plan für die Zukunft, den er nur noch nicht bekanntgeben möchte, weil er vielleicht manche erschrecken oder demotivieren könnte. |
|
|
Doch auch wenn der Vorstand und das Top-Management kein vollständiges Bild von der Zukunft haben und es auch nicht haben können, haben sie die Aufgabe und Verpflichtung, möglichst weit vorauszudenken und vorauszuschauen. An diesen Überlegungen kann man die Belegschaft bei aller Ungewissheit durchaus teilhaben lassen, indem man zwei Punkte thematisiert, nämlich erstens: Welche Entwicklungen sehen wir im Markt, auf die wir reagieren müssen? Und zweitens: Welche eigenen Akzente und Initiativen wollen wir in den nächsten Monaten und Jahren setzen, um unsere Wettbewerbsposition zu stärken? Eine exakte "Straßenkarte in die Zukunft" kann das naturgemäß nicht sein, aber eine Art magnetischen Nordpol kann es sehr wohl liefern. |
|
|
Das macht einen beträchtlichen Unterschied: Durch eine klare, logisch aufgebaute Veränderungsstrategie wird das Unternehmen vom Getriebenen zum Treiber der Entwicklung. Man muss nicht mehr rennen wie ein Verrückter, um auf der Stelle zu bleiben, man hat einen Plan, wie man die eigene Wettbewerbsfähigkeit erhalten und sie schrittweise steigern will. Und man hat – wie befreiend! – damit auch Kriterien, anhand derer man entscheiden kann, worauf man sich konzentriert – und damit auch, was man zurückstellt oder wovon man ganz die Finger lässt. |
|
|
Vom Erklären in den Dialog |
||
|
Wenn das Top Management will, dass sich die Belegschaft auf diesen Blick in die Zukunft samt der provisorischen "Straßenkarte" positiv einlässt, darf es sich einer Diskussion nicht entziehen. Es muss sowohl ein Hinterfragen der strategischen Logik zulassen als auch eines des Zeit- und Ressourcenbedarfs. Wenn es sich dieser Diskussion nicht stellt, entsteht bei den operativen Mitarbeitern und Führungskräften unweigerlich das Gefühl, dass sie bei diesem Spiel die Dummen sind: Das Management denkt sich in seinen klimatisierten Etagen unablässig schöne Projekte aus und kippt sie in das ohnehin überlastete System. Und sie, die Betroffenen, müssen es ausbaden, ohne dass sich irgendwer dafür interessiert, wie sie das mit den verfügbaren Ressourcen unter dem Druck des Tagesgeschäfts schaffen sollen. |
|
|
|
Nun gehen Engpässe erfahrungsgemäß nicht davon weg, dass man über sie redet. Trotzdem ist es für die Leute ein Unterschied, ob man ihre Sichtweise erstens zur Kenntnis und zweitens ernst nimmt oder nicht. Kaum jemand wird erwarten, dass das Management die aus seiner Sicht notwendigen Veränderungen wegen dieser Einwände abbläst – aber es muss möglich sein, ernsthaft darüber zu reden, wie sich konkurrierende Ziele, Interessen und Prioritäten unter einen Hut bringen lassen. |
|
|
Dazu zählt auch, sich darüber zu verständigen, ob man die zur Realisierung der Veränderung notwendige Arbeit noch "obendrauf packen" kann oder ob man andere Lösungen finden muss, wie etwa eine zeitweilige Entlastung oder eine Umverteilung von Aufgaben. Letztlich ist es auch für das Management von Nutzen, wenn es auf diese Weise ein realistisches Bild davon bekommt, was es den Leuten noch zumuten kann und wo das System an seine Überlastungsgrenzen stößt. |
|
|
|
Es ist auf die Dauer keine Lösung, diese Grenzen fröhlich zu ignorieren und darauf zu bauen, dass die Leute das, wenn auch unter Schimpfen und Stöhnen, am Ende doch irgendwie schaffen werden. Oder sich gar in Bildern zu ergehen, welche die Realität nonchalant ignorieren, wie etwa: "Wir stehen vor der Notwendigkeit, mitten im Flug die Flügel auszutauschen und neu zu montieren." Solche Metaphern sind tückisch, weil sie ein böses Ende nahelegen – wenigstens für diejenigen, die davon ausgehen, dass selbst der Vorstand physikalische Gesetze nicht außer Kraft setzen kann. |
|
|
|
Die Grenzen der Belastbarkeit einer Organisation verschwinden nicht dadurch, dass das Top-Management sie ignoriert. Zwar spart man vielleicht kurzfristig ein paar Euro, wenn man die Leute über ihre Grenze hinaus belastet, aber auf mittlere Sicht ist es nicht nur menschlich, sondern auch ökonomisch ein unverzeihlicher Fehler, eine ganze Organisation oder Teile davon in den Burnout zu fahren. Zumal auf dem Weg dorthin auch die Fehlerquote steigt. |
|
|
|
Arbeit braucht Zeit, gute Arbeit braucht gut Zeit |
||
|
Letztlich kommt man auch bei Veränderungsvorhaben an einer simplen Erkenntnis nicht vorbei: Arbeit braucht Zeit, und gute Arbeit braucht gut Zeit. Da hilft es auch nichts, auf das Pareto-Prinzip zu verweisen, wonach 80 Prozent des Nutzens mit 20 Prozent des Aufwands geschaffen werden. |
|
|
|
Weder Vilfredo Pareto noch irgendein anderer Forscher hat behauptet oder gar bewiesen, dass es die ersten 20 Prozent der Arbeit sind, in denen 80 Prozent des Nutzens geschaffen wird. Deshalb hilft es auch wenig, zur "Konzentration aufs Wesentliche" aufzufordern: Gerade auf Neuland ist das leichter gefordert als getan. Denn um sich aufs Wesentliche konzentrieren zu können, müsste man wissen, was wesentlich ist – doch genau das weiß man auf Neuland in aller Regel nicht. |
|
|
Bei Change-Projekten ist der Zusammenhang zwischen Zeiteinsatz und Ergebnisqualität weder linear noch vollständig vorhersehbar. Selbst wenn sich am Ende zeigen lässt, dass auch im konkreten Fall 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent des Nutzens gebracht hat, ist eher unwahrscheinlich, dass es die ersten 20 Prozent waren. Wer je Projektarbeit gemacht hat, weiß, dass die ersten Tage und Wochen häufig mit Sondieren, Diskutieren, Explorieren, Ausprobieren und Sich-Sortieren vergehen – und häufig auch mit Dingen, die sich im Nachhinein als Um-, Ab- oder Seitenwege erweisen. Im Rückblick betrachtet, sind gerade die ersten 20 Prozent der Projektarbeit selten ein Musterbeispiel von klarer Fokussierung, Effizienz und Produktivität. (Und die nächsten 20 Prozent meistens auch nicht …) |
|
|
|
Irrwege erkennt man oft erst nachträglich, wenn man die Sache besser durchdrungen hat. Im Rückblick stellt man durchaus manchmal fest: Wenn wir damals gewusst hätten, was wir heute wissen, hätten wir uns einige Arbeit sparen können. Aber ich habe noch nie jemanden sagen hören: "Bevor wir mit dem Projekt richtig loslegen, lasst uns erst einmal ein paar überflüssige Dinge machen." Nein, ganz am Anfang muss man sich erst einmal orientieren und das Feld sondieren, bevor ein halbwegs stringenter Plan entstehen kann. |
|
|
Der ungünstigste Fall: "Pareto im Kopfstand" |
||
Die nüchterne Wahrheit ist: Große Durchbrüche stehen selten am Anfang – der größte Mehrwert eines Projekts wird oft erst auf den letzten Metern geschaffen. Deshalb ist es mehr als eine theoretische Möglichkeit, dass 80 Prozent des Nutzens eines Projekts erst durch die letzten 20 Prozent der Arbeit entstehen. Fatal also, wenn man ausgerechnet die "aus Effizienzgründen" abschneidet bzw. wenn die Leute so unter Druck sind, dass sie nicht mehr die Energie dazu aufbringen, die Sache zu Ende zu denken, und stattdessen auf zeitsparende Abkürzungen setzen. |
|
|
Das ist weit mehr als eine theoretische Sorge: Genau diese Suche nach zeitsparenden Abkürzungen habe ich schon oft erlebt, wenn die Mitstreiter von Projektteams keine zeitliche Entlastung für die Arbeit im Projekt bekamen: Dann geht das anfängliche Engagement für die Sache, je mehr die Zeit fortschreitet – und je mehr das Tagesgeschäft zunächst ruft, dann schreit und schließlich brüllt –, immer mehr in ein nacktes Erledigungsinteresse über: Man will die Sache hinter sich bringen, egal wie, und nimmt dafür auch Abkürzungen in Kauf, von denen man weiß oder ahnt, dass sie dem Ergebnis nicht zuträglich sind. |
|
|
Das ist dann sozusagen Pareto im Kopfstand: Man hat 80 Prozent der Zeit ausgegeben, fährt aber nur 20 Prozent des möglichen Ergebnisses ein, weil es an der Zeit und Kraft für einen sauberen Abschluss fehlt. Das ist nicht nur von der Sache her fatal. Denn natürlich sehen Beteiligte wie Unbeteiligte, dass trotz des ganzen Aufwands nicht viel herausgekommen ist. Sie sehen, wie viel Zeit und Kraft eingesetzt wurde, aber auch, dass das Ergebnis zu wünschen übrig lässt und weit hinter dem zurückbleibt, was angestrebt war und möglich gewesen wäre. Das prägt die Erwartungen an die nächsten Projekte: Viel Arbeit, viel Stress, magere Resultate. Demotivierender kann eine Erfahrung kaum sein. |
|
|
Bereitstellen der erforderlichen Ressourcen |
||
Auf den ersten Blick scheint das Problem ziemlich einfach zu lösen: Wenn immer mehr Veränderungen erforderlich sind – oder auch nur eine konstant hohe Zahl –, dann müssen eben die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden. Wo soll da das große Problem sein? Doch wenn man diesen recht naheliegenden Vorschlag macht, fallen die Reaktionen oftmals so aus, als hätte man ein Tabu gebrochen und oder verbotene oder zumindest ziemlich unerwünschte Wahrheit ausgesprochen. |
|
|
Warum ist das so? Weil mehr Ressourcen natürlich höhere Kosten bedeuten – und das Management es lieber hätte, wenn die Veränderungen, so wie bisher, nebenher miterledigt würden, ohne nennenswerte Zusatzkosten. Vielleicht ein paar Beratertage, die einmalig anfallen und deren Kosten mit Abschluss des Vorhabens auslaufen, aber auf keinen Fall dauerhafte Fixkosten. Das ist ein verständlicher und im Kern sinnvoller Reflex, denn unternehmerisches Handeln heißt immer auch, ein wachsames Auge auf die Kosten zu haben. Und noch besser als jede Kostensenkung ist, vermeidbare Kosten gar nicht erst aufzubauen. |
|
|
Die Frage ist nur, ob diese Kosten auf die Dauer vermeidbar sind. Auch in anderen Fällen wie etwa der IT haben wir uns ja daran gewöhnen müssen, dass neue Kostenblöcke hinzukommen, die es früher nicht gab. Und bei denen, wenn man ehrlich ist, schwer zu bestimmen ist, ob der verheißene Produktivitätsgewinn tatsächlich eingetreten ist – und damit die erhofften Kostenersparnisse an anderer Stelle. Sicher ist nur, dass es keine wirkliche Alternative gibt: Genau wie man nicht die Wahl hat, auf IT zu verzichten, hat man auf die Dauer auch nicht die Wahl, ohne die erforderlichen Ressourcen auszukommen, wenn man mehr oder weniger simultan eine große Zahl von Change-Vorhaben erfolgreich umsetzen will. |
|
|
Wenn Veränderungen heute wie in Zukunft der Regelfall, sagen wir damit implizit ja auch, dass der dafür entstehende Zeit- und Ressourcenaufwand keine einmalige und vorübergehende Mehrbelastung ist, sondern ein Dauerzustand. Also wäre es wohl unrealistisch, zu glauben, man könnte diesen Zusatzaufwand den mit dem Tagesgeschäft ausgelasteten Mitarbeitern und Führungskräften dauerhaft obendrauf packen. Das führte nur in die beschriebene Überlastung samt ihrer emotionalen und ökonomischen Folgeschäden. |
|
|
Vom Krisenmanagement zum Geschäftsmodell |
||
Wenn Veränderungen jetzt und in Zukunft der Normalfall sind, dann hat das die logische Konsequenz, dass wir zu einem fundamental anderen Management von Veränderungsprozessen kommen müssen. Dann wäre es widersinnig, sie weiterhin wie eine Ausnahmesituation zu handhaben: Das wäre der Weg der roten Königin, der geradewegs in den Burn-Out führt. Es ist auch nicht damit getan, dass wir nur unsere Kräfte besser einteilen. Vielmehr müssen das Spiel neu definieren und eher in Richtung Intervall-Training denken als in Richtung Sprint mit anschließender Erholung. |
|
|
Doch eine andere Einstellung reicht nicht, wir müssen unsere Strukturen und Prozesse an die veränderte Realität anpassen. Unsere heutige Art, das Geschäft zu betreiben, ist immer noch so angelegt, als ob relative Stabilität die Regel wäre und Veränderungen die Ausnahme. Da das empirisch einfach nicht (mehr) stimmt, entstehen genau jene Reibungen mit der Realität, die Mitarbeiter und Führungskräfte heute vielerorts aufreiben. Da unwahrscheinlich ist, dass die Realität Einsicht zeigen und nachgeben wird, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als den ständigen Bedarf für Veränderungen auch in unseren Strukturen und Prozessen abzubilden. |
|
|
In einigen Bereichen ist dies längst gelungen. Automobilunternehmen etwa haben ihre größten und wichtigen Veränderungsprozesse institutionalisiert: Sie haben einen Modellzyklus von etwa 5 bis 7 Jahren – in diesem Abstand kommt ein neuer Golf, eine neue S-Klasse und eine neue 5er-Reihe heraus. Die daraus entstehenden Veränderungswellen, die zyklisch das ganze Unternehmen durchziehen, sind vorhersagbar – und fest eingeplant. |
|
|
Das war aber wohl nicht immer so. Man darf davon ausgehen, dass in der automobilen Frühzeit ein Pionier wie Ford irgendwann mit Schrecken feststellen musste, dass sich sein Modell T nicht mehr so gut verkaufte wie in den Jahren zuvor. Als erste Sofortmaßnahme beschloss man damals vermutlich, das Problem "nicht überzubewerten" und es als vorübergehende Absatzdelle abzutun – schließlich wusste jeder, wie beliebt und erfolgreich das Modell T war. Bis man irgendwann die bittere Erkenntnis an sich heranlassen musste, dass viele Kunden die inzwischen herausgekommenen moderneren Modelle der Konkurrenz einfach attraktiver fanden. Daraufhin wurde wohl hektisch ein Projekt eingerichtet, um mit Hochdruck ein neues Modell zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. |
|
|
Einige Jahre später mag sich das gleiche Drama erneut abgespielt haben – bis man irgendwann erkannte, dass das keine unvorhersehbaren Krisen sind, sondern der normale Zyklus des Geschäfts. Im Laufe der Zeit hat man das wiederkehrende Drama "gezähmt", indem man besser geeignete Strukturen und Prozesse schuf: Man baute einen neuen Bereich "Entwicklung" auf, dessen zentrale Aufgabe darin bestand, nicht erst auf Absatzprobleme zu reagieren, sondern vorausschauend in regelmäßigen Abständen neue Modelle bereitzustellen. Das gesamte Unternehmen, vor allem aber Produktion und Vertrieb, gewöhnte sich an die regelmäßigen Modellwechsel. Heute sind Modellwechsel immer noch stressig, aber sie sind keine Krise mehr. Stattdessen sind sie fester Teil der Jahresplanung, dem man mit einer Mischung von Nervosität und freudiger Erregung entgegenblickt. |
|
|
Change institutionalisieren |
||
|
Die psychologische Auswirkung dieses "Paradigmenwechsels" ist spektakulär – er bewirkt eine veränderte Betrachtung der Realität und damit auch eine völlig andere Gefühlslage: Was vorher Krise und Ausnahmesituation war, wird damit Normalität. Heute weiß jeder, dass alle paar Jahre ein Modellwechsel kommt, und hat sich darauf eingerichtet. Natürlich ist trotzdem jede Umstellung mit Stress verbunden, mit Anspannung und der Sorge, ob alles gut geht und ob man an alles gedacht hat, vielleicht auch mit Ängsten und vorbeugenden Schuldzuweisungen. Aber die große Panik und das lähmende Krisengefühl sind weg – die wiederkehrende Veränderung ist zur professionellen Routine geworden. |
|
|
Wie das Beispiel der Autoindustrie zeigt, reichen die Veränderungen weit über die zuständige Abteilung hinaus: Auch wenn die turnusmäßige Einführung neuer Modelle in der Entwicklung vorbereitet wird, erfasst und bestimmt sie jedes Mal die ganze Firma. Die Produktion muss in kurzer Zeit umgestellt werden, was erhebliche Umbauarbeiten erfordert, die Beschaffung der benötigten Teile muss organisiert werden, das Marketing muss neue Kampagnen vorbereiten und durchführen, Vertrieb und Service müssen geschult, Werkstätten für die Wartung der neuen Modelle befähigt, die Logistik überprüft und angepasst werden und vieles andere mehr. |
|
|
|
Ein Jahr später kommt beinahe routinemäßig der nächste Modellwechsel – und zwar abermals, ohne dass es sich wie eine Krise anfühlt oder gar ein Burnout droht. Warum schon ein Jahr später, wo man das neue Modell doch gerade erst auf den Markt gebracht hat? Weil die großen Automobilisten ja nicht nur ein Modell herstellen. Klugerweise hat man die Wechsel der verschiedenen Modelle gestaffelt und damit entzerrt, um nicht alle paar Jahre eine gigantische Spitze zu haben und dann jahrelang gar nichts. Infolgedessen gibt es fast jedes Jahr einen Modellwechsel – oder mehrere. |
|
|
|
Offensichtlich ist es den Autobauern – und auch etlichen anderen Branchen – gelungen, bestimmte Arten wiederkehrender Veränderungen zu "Routine-Projekten" zu machen, die fest eingeplant sind und vor denen sich niemand mehr fürchtet, die stattdessen als Bewährungschance für Nachwuchskräfte genutzt werden. Der Begriff "Routine-Projekte" steht zwar im eklatanten Widerspruch zu der gängigen Projektdefinition, die Projekte gerade gegen Routine abgrenzt, aber das Phänomen ist trotzdem erstens real und zweitens ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Zeit, als die Entwicklung und Einführung eines neuen Modells noch als Krisenmanagement verstanden und gehandhabt wurde. |
|
|
In ähnlicher Weise sollten wir in der heutigen Zeit über Change-Projekte und Change Management nachdenken. Es ist höchste Zeit, die Konsequenzen aus der vielbeschworenen Erkenntnis zu ziehen, dass das Geschäftsleben und damit auch die Realität fast aller Unternehmen von ständigen Veränderungen geprägt ist und davon auch in Zukunft bestimmt sein wird. Wenn Top-Manager ernst nehmen, was sie selbst seit Jahren predigen, kann die Schlussfolgerung eigentlich nur lauten, Change in ähnlicher Weise zu institutionalisieren, zu routinisieren und damit auch zu normalisieren wie die Modellwechsel der Autoindustrie. |
|
|
Wie man das am besten ausgestaltet, hängt von der Größe und Struktur der eigenen Firma ab. Großunternehmen bündeln die erforderlichen Ressourcen oft in einer eigenen internen Unternehmensberatung, kleinere können sie zum Beispiel als Organisationsentwickler im Stab der Geschäftsführung oder im HR-Bereich vorhalten. Als zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung von Veränderungsvorhaben können zum Beispiel Nachwuchs-Führungskräfte oder fortgeschrittene Trainees eingesetzt werden. Bei Bedarf können Know-how und Ressourcen von externen Beratungsfirmen zugekauft werden. Auch etliche andere Modelle sind denkbar, aber irgendein Modell, wie es die kontinuierlich anstehenden Veränderungen bewältigen will, braucht inzwischen wohl jedes Unternehmen. |
|
|
Durch Change-Planung Ordnung in die Sturzfluten bringen |
||
Wer in der heutigen Zeit immer noch jedesmal wieder aufs Neue von der Notwendigkeit von Veränderungen überrascht wird und daraufhin immer neue Ad-hoc-Projekte vom Zaun bricht, agiert ähnlich weitsichtig wie jemand, der jedes Jahr aufs Neue von Ostern und Weihnachten überrumpelt wird. Auf die Dauer erweckt er damit den Verdacht, er habe das System hinter den Einzelereignissen nicht verstanden. |
|
|
Aber was genau heißt es, wiederkehrende Veränderungen als Teil unserer geschäftlichen Routine zu verstehen und sie entsprechend zu handhaben? Das beginnt damit, dass wir sie in unseren Prozessen und Systemen abbilden und Ressourcen für sie einplanen, ähnlich wie es die Autoindustrie mit der Institutionalisierung der Entwicklung und mit den Taskforces getan hat, die jeden Modellwechsel begleiten. |
|
|
So wie es im Jahresrhythmus Planungen für Produktion, Vertrieb und andere Funktionen gibt, muss es auch eine Planung für anstehende Veränderungen geben. Für viele Firmen wird wahrscheinlich es am sinnvollsten sein, die im bevorstehenden Geschäftsjahr anstehenden Veränderungen im Zusammenhang mit der gesamten Jahresplanung zu machen, diese Planung nachzuhalten und sie bei Bedarf fortzuschreiben. |
|
|
Aber geht denn das? Kann man Veränderungen tatsächlich langfristig planen, ohne sie erstens zu bürokratisieren und zweitens an kurzfristig entstehenden Veränderungsnotwendigkeiten vorbeizuplanen bzw. sie zu verschleppen, weil sie, bevor man mit der Arbeit beginnen kann, erst einmal durch die Mühlen der Planung gedreht werden müssen? Ja, nach meiner Überzeugung ist das möglich und sinnvoll. Und es muss keineswegs zu einer Bürokratieorgie werden. |
|
|
Denn Veränderungen sind planbarer als viele glauben. Nur ein kleiner Teil, vermutlich weniger als 10 Prozent, sind Reaktionen auf unerwartete äußere Entwicklungen, die keinen Aufschub dulden. Klar, wenn der größte Kunde ausfällt oder eine Pandemie wie Corona hereinbricht, muss man sofort reagieren und kann sich damit nicht hinten in die Schlange einreihen. Aber selbst hier muss man trennen zwischen den Sofortmaßnahmen, die im Zuge des unmittelbaren Krisenmanagements erforderlich werden, und den strategischen Anpassungen, die aus einer veränderten Markt- und Wettbewerbssituation abgeleitet werden müssen – und die sich im frühen Stadium einer Krise oft noch gar nicht absehen lassen. |
|
|
Große Change-Vorhaben entstehen nur ausgesprochen selten spontan aus Krisen oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen. Das liegt nicht nur daran, dass solche "Erdbeben" (glücklicherweise) selten sind – es liegt vor allem daran, dass man selbst nach dramatischen Entwicklungen meist eine Weile Zeit braucht, um die richtige strategische Antwort auf die veränderte Lage zu finden. Und noch etwas länger, bis man sie auf konkrete Change-Projekte heruntergebrochen hat. Denn erst wenn man seine Strategie neu ausgerichtet hat, lässt sich ableiten, welche konkreten Change-Projekte sich daraus ergeben. |
|
|
Koordinierung und Entzerrung der Change-Vorhaben |
||
Ein wesentliches Element der Change-Planung muss sein, die anstehenden Change-Vorhaben zu koordinieren, zeitlich zu strukturieren und zu entzerren. Auch hier lässt sich von den Autobauern lernen, die ihre Modellwechsel aus guten Gründen gestaffelt haben. Wenn man Zusammenballungen nicht frühzeitig durch eine gute Planung verhindert, lassen sich spätere Engpässe und Konflikte mit dem Tagesgeschäft kaum noch vermeiden. Dann greifen zu viele Stellen gleichzeitig auf die gleichen Ressourcen zu – oder versuchen es wenigstens. Das wiederum führt unvermeidlich zu Ärger, Frustration und Verzögerungen. |
|
|
Die Koordinierung aller anstehenden Change-Vorhaben zwingt auch zu einer Priorisierung – was immer eine gute Sache ist. Vermutlich entdeckt man dabei auch Change-Vorhaben, die bei genauerer Betrachtung angesichts anderer dringender Handlungsnotwendigkeiten zweite oder dritte Priorität haben – oder eigentlich gar keine mehr. Oder die von anderen anstehenden Vorhaben überholt und hinfällig gemacht werden. |
|
|
Die priorisierten Projekte müssen mit den vorhandenen Ressourcen abgeglichen werden, insbesondere mit denen, auf die absehbar mehrere Projekte zugreifen werden und/oder die durch das Tagesgeschäft hoch belastet sind. Dabei kann man schon mal für begrenzte Zeit in den "roten Bereich" des Drehzahlmessers gehen, aber man sollte sich hüten, das zu lange zu tun, sonst droht genau wie bei einem Motor ein Totalschaden. Da der Punkt, an dem der Motor ausfällt, nicht exakt vorherzubestimmen ist, ist es ratsam, einen gewissen Sicherheitsabstand davon zu halten. |
|
|
Damit schließt sich der Kreis. Hat man einen solchen strategischen Plan, nach dem die anstehenden Veränderungen angegangen und koordiniert werden, sollte man ihn auch kommunizieren und erklären: Nicht nur, was kommt, sondern auch, warum es kommt und warum in genau dieser Reihenfolge. Auf diese Weise kommt Ordnung in das Chaos der Veränderung, und entsprechend reduziert sich das Gefühl, ständig von neuen Veränderungswellen erfasst und überrollt zu werden. |
|
|
Natürlich können trotzdem überraschende Entwicklungen eintreten, die zu einer Änderung der Planung zwingen – davor kann keine Priorisierung und kein Ressourcenmanagement schützen. Aber das sind dann nachvollziehbare Ausnahmefälle, es ist nicht mehr der Normalzustand. Und es wird in der Regel auch verstanden und akzeptiert. |
|
|
Der psychologische Effekt einer guten, realistischen Change-Planung ist enorm. Das Gefühl des Kontrollverlusts verschwindet oder geht zumindest zurück, desgleichen das Gefühl, in den Fluten der Veränderung mit letzt3er Kraft gegen das Ertrinken zu kämpfen. Das Gefühl des permanenten Krisenmanagements wird abgelöst durch ein zügiges, aber gelassenes Abarbeiten dessen, was ansteht. Man muss eben nicht rennen wie verrückt, um auf der Stelle zu bleiben, man kann sich mit zügigem, aber zielgerichteten Gehen, sprich mit dem konsequenten Realisieren der geplanten Veränderungen einen Vorsprung erarbeiten. |
|
|
|
||
|
||
|