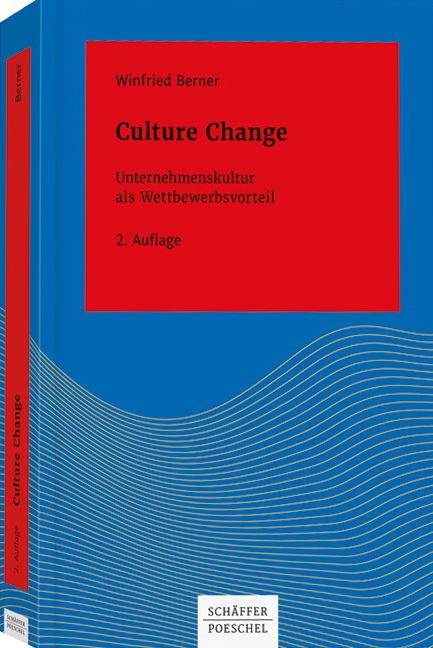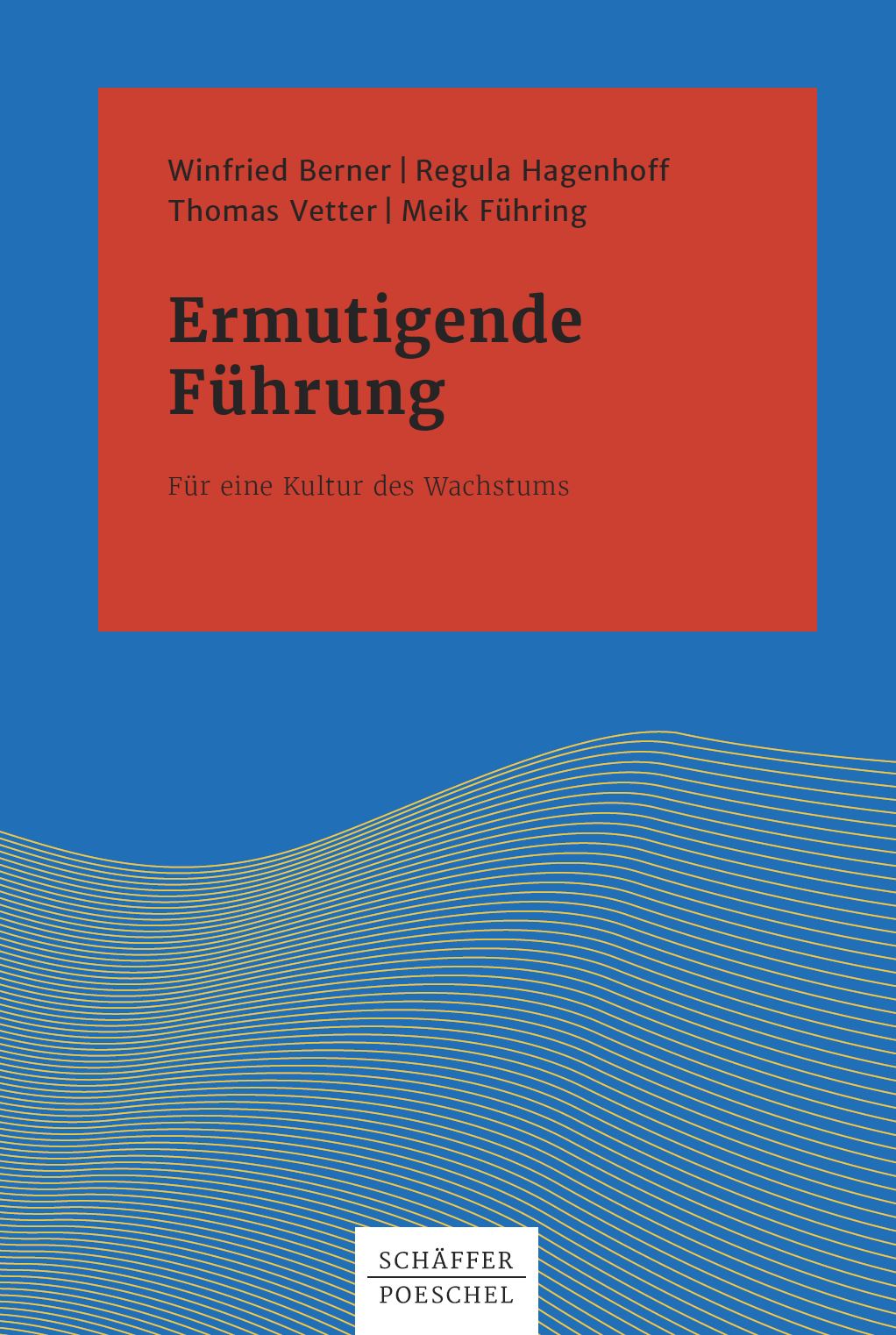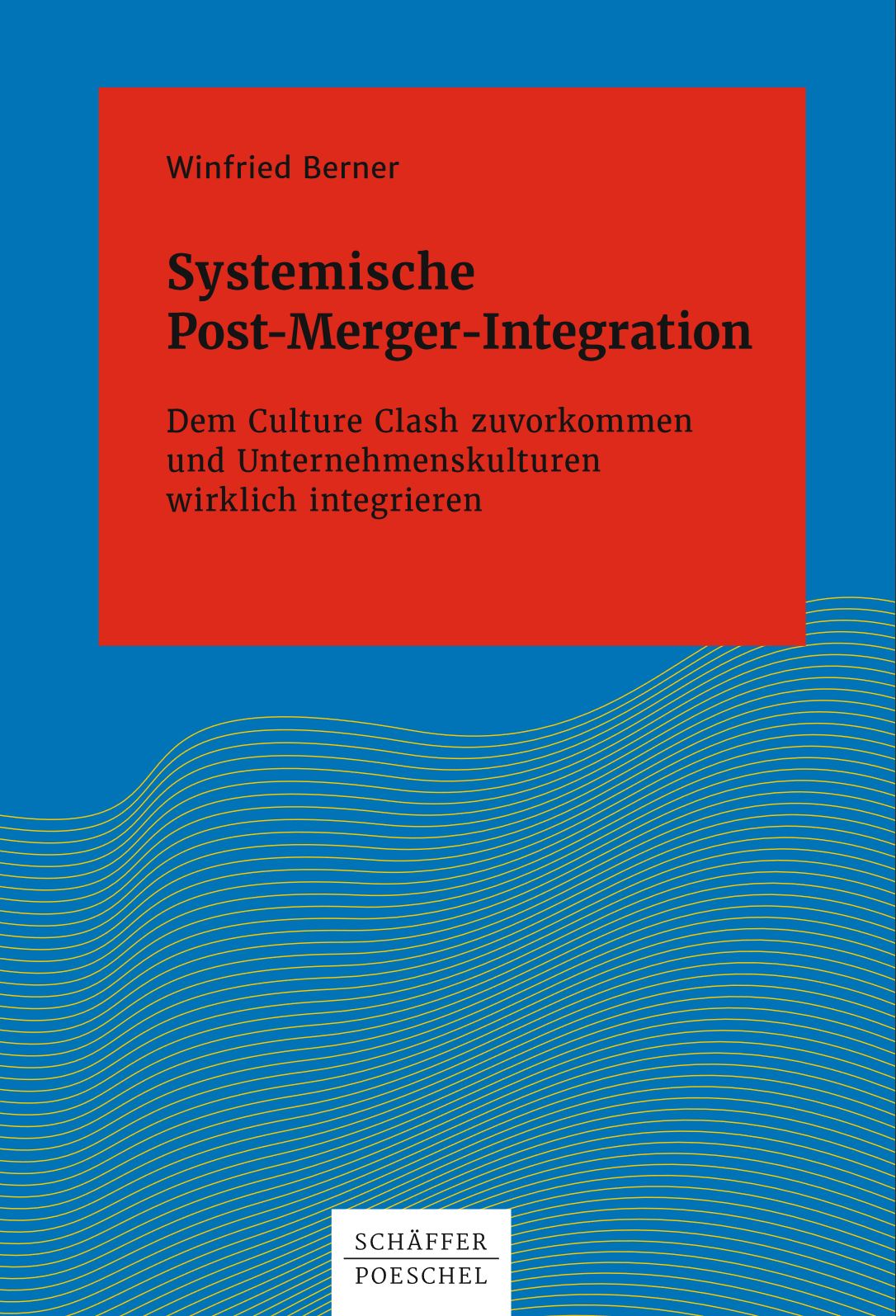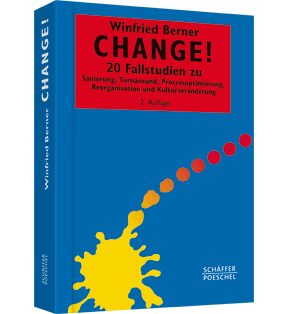Die Psychologie der Veränderung
|
||||||||||||||||||||
Persönlichkeitsentwicklung: Sich selbst weiterentwickeln statt nur das Methodenrepertoire |
||
|
Im Change Management gibt es eine Tendenz zur "Methodenhuberei": Nicht wenige setzen ihre Hoffnungen darauf, sich für die vielfältigen Anforderungen dadurch zu rüsten, dass sie ihr Methodenrepertoire immer weiter ausbauen. Ich halte das für einen Irrweg, der mehr der Bekämpfung eigener Ängste und Minderwertigkeitsgefühle dient als der Steigerung der Effektivität. Nichts gegen ein breites Methodenrepertoire, aber genau wie man auch mit einem geringen Wortschatz sehr wirksam kommunizieren kann, so ist auch der Umfang des "Methodenschatzes" nicht der kritische Engpass für gutes Change Management. Viel wichtiger ist die eigene Persönlichkeit – insbesondere die Fähigkeit, komplexe soziale Situationen richtig einzuschätzen und adäquat mit ihnen umzugehen. Der wirkliche Königsweg zu (noch) besserem Change Management ist daher nach meiner Überzeugung die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. |
|
|
|
Warum ist die Persönlichkeit, wenigstens in meinen Augen, so zentral und elementar? Weil alles andere davon abhängt – einschließlich der Auswahl der Methoden und Tools. Gleich wie genial eine Methode ist, wenn die Annahmen falsch sind, auf denen ihr Einsatz beruht, oder wenn sie hauptsächlich zum Einsatz kommt, um den Auftraggeber zufriedenzustellen und/oder die Kolleginnen zu beeindrucken, wird ihr Beitrag zum Change enttäuschend ausfallen. Im ungünstigsten Fall richtet sie sogar Schaden an – wie etwa, wenn ein Großgruppenevent unerfüllbare Erwartungen weckt oder wenn eine zu euphorische Kommunikation der Glaubwürdigkeit eines Vorhabens und damit auch der des Managements abträglich ist. |
|
|
Erfolgsfaktor Persönlichkeit |
||
Jede Intervention im Change Management steht und fällt damit, wie zutreffend die Einschätzung der Situation und des Handlungsbedarfs ist, auf der sie beruht. Dabei können wir uns in aller Regel nicht auf verlässliche Daten und Fakten stützen, deshalb hängt alles an unserer Empathie und Wahrnehmungsqualität. Um unsere eigene Perspektive zu verbreitern, ist es hilfreich, die Sichtweisen von Menschen aus unterschiedlichen Teilen des Unternehmens einzuholen, also keine Einweg-Kommunikation zu betreiben, sondern sich einen Rückkanal aufzubauen; noch wichtiger ist aber, aus den Rückmeldungen, die man bekommt, ein möglichst unverfälschtes Bild der aktuellen Lage abzuleiten. |
|
|
Was das mit Persönlichkeit zu tun hat? Nun, unter Stress sind Empathie und Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigt – und Change Manager stehen zuweilen unter Stress. Als Stressoren können zum einen die hohen, oft kaum erfüllbaren Erwartungen des Auftraggebers bzw. der Projektleitung wirken, zum anderen die Tatsache, dass man oft mit völlig widersprüchlichen Sichtweisen, Empfehlungen und Forderungen konfrontiert ist, vor allem wenn man mit unterschiedlichen Bereichen und Hierarchieebenen spricht. Nicht nur, dass man all diesen Wünschen und Erwartungen kaum gerecht werden kann, oft ist es schwierig, aus diesem dissonanten Konzert überhaupt eine durchgängige Melodie herauszuhören. Trotzdem muss man seinen eigenen Kurs finden und in einer recht diffusen Situation handeln, ohne sich von Widersprüchen entmutigen zu lassen und ohne sich durch die oft widersprüchlichen Forderungen und Empfehlungen zu sehr unter Druck setzen zu lassen. |
|
|
Das erfordert einiges Stehvermögen und den Mut, nach seiner eigenen Überzeugung zu handeln, auch wenn es vorab keinen Beweis für ihre Richtigkeit gibt. Wer es in dieser chaotischen Situation mit der Angst zu tun bekommt, wird dazu tendieren, der Verantwortung aus dem Weg zu gehen und sich lieber hinter anderen zu verstecken, etwa, indem er dem Auftraggeber zu entlocken versucht, wie er es denn gerne hätte, oder indem er den Forderungen einer dominanten, aber nicht unbedingt sachkundigen Projektleiterin folgt. Dann war man, wenn es schiefgeht, zumindest nicht schuld – oder zumindest nicht alleine. |
|
|
Auch im Verhältnis zum Auftraggeber ist "Persönlichkeit" gefragt. Loyalität darf sich nicht in blindem Gehorsam niederschlagen, sie äußert sich im Gegenteil im Mut zum Dissens mit dem Auftraggeber und anderen "Platzhirschen". Zwar hat der Auftraggeber am Ende natürlich das letzte Wort, doch sollten Change Manager ihre Sichtweisen unerschrocken einbringen, kontroversen Diskussionen nicht aus dem Weg gehen und vor allem bewusst darauf verzichten, ihre Empfehlungen in vorauseilendem Gehorsam so zurechtzubiegen, wie sie vermutlich am besten den Wünschen des Auftraggebers entsprechen: Ein Change Manager, der in diesem Sinne zuweilen anstrengend ist, leistet unter dem Strich einen größeren Erfolgsbeitrag als ein allzu "pflegeleichter". |
|
|
Von der Ichbezogenheit zum Dienst an der Sache |
||
Wer seine Rolle als Change Manager so versteht und akzeptiert, gerät unter Umständen in die Versuchung, sich und anderen seinen Mut zum Dissens zu beweisen – und damit in der anderen Richtung übers Ziel hinauszuschießen. Verräterisch ist das Wörtchen "beweisen": Jede Beweisführung dient ja dazu, Zweifel auszuräumen – eigene oder fremde. Das ist jedoch ist ein ebenso selbstbezogenes Ziel wie das Sich-hinter-anderen-Verstecken, nur mit umgekehrten Vorzeichen: "Seht, wie tapfer ich bin!" |
|
|
Demonstrativ mutige Auftritte dienen letztlich nicht dazu, die gemeinsame Sache voranzubringen, sie dienen dazu, sich selbst ins richtige Licht zu setzen: sich zu profilieren, Zweifel zu bekämpfen, also letztlich eigene Probleme zu lösen. Nur dass das Problem in diesem Fall nicht die Angst vor der Verantwortung ist, sondern die Befürchtung, als zu furchtsam wahrgenommen zu werden. Oder auch das Bestreben, für seinen Mut bewundert zu werden. All das sind selbstbezogene Motive, keine sachbezogenen. |
|
|
Wem es allein darum geht, die Sache weiterzubringen, für den ist es überflüssig, irgendetwas zu beweisen – für den oder die geht einfach darum, zu tun, was die Situation erfordert: nicht beweisen, einfach machen, sein Bestes geben, um den Change-Prozess voranzubringen. Dafür ist es erforderlich, sich voll in den Dienst der Aufgabe zu stellen und die eigene Person und ihre ichbezogenen Bedürfnisse bewusst zurückzunehmen: In einem Change-Prozess geht nicht darum, wonach mir als Change Manager gerade ist, wie ich wahrgenommen werden möchte, welche Kunststücke ich gerne vorführen würde oder auch, wovor ich Angst habe, es geht allein darum, was die Sache erfordert, was also in der aktuellen Situation notwendig und sinnvoll ist: Konsequent sachbezogen statt ichbezogen. |
|
|
Derart hinter der Sache zurücktreten zu können, ist letztlich eine Frage der persönlichen Reife – und damit eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Es setzt voraus, dass man nicht (mehr) allzu sehr mit sich selbst beschäftigt ist oder damit, wie andere einen sehen und was sie über einen denken könnten. Das muss nicht heißen, dass einen diese Fragen gleichgültig sind, aber es erfordert die Fähigkeit, sie zeitweilig hintan zu stellen. Und zwar immer dann, wenn die Sache bzw. die Situation es erfordert. |
|
|
Zwei Ebenen des Lernens: Wissen und Erfahrung sammeln … |
||
Es wäre unrealistisch zu erwarten, dass frischgebackene Change Manager diese Anforderungen bereits bei ihrem ersten oder zweiten Change-Projekt erfüllen. In glücklichen Einzelfällen mag dies der Fall sein, aber eine faire Erwartung wäre es nicht: Wenn man ihr (noch) nicht gerecht wird, lässt dies keine negativen Rückschlüsse auf die eigenen Talente und Fähigkeiten als Change Manager zu. Bei den meisten Menschen erfordert es einen längeren Lernprozess, dahin zu kommen, und dieser Lernprozess geht wie alle Lernprozesse mit Plateaus und Rückschlägen einher. Auch die eigene Persönlichkeit muss über die Zeit wachsen (dürfen), auch wenn dies zur Folge hat, dass zuweilen Fehler passieren, die man mit etwas mehr Erfahrung und Reife hätte vermeiden können. |
|
|
"Erfahrung" ist freilich mehr als die bloße Häufigkeit, mit der man einen Fehler schon wiederholt hat. Damit Erfahrung mehr ist als eine Wiederkehr der immer gleichen Muster, muss man aus ihr lernen. Dieses Lernen hat zwei Teile. Der erste, einfachere ist die Ausbildung realistischer(er) Erwartungen und geeigneter Handlungsstrategien. Der zweite und anspruchsvollere ist, sich selbst besser kennenzulernen. |
|
|
Das Ausbilden realistischer(er) Erwartungen ist einfache Mustererkennung. Wer zum Beispiel ein paar IT-Projekte miterlebt hat, wird feststellen, dass sie fast immer in drei Phasen verlaufen: einer ersten, in der sich kaum jemand aus dem Business sonderlich für das Projekt interessiert, einer zweiten kurz vor dem Go-Live, in der plötzlich große Aufregung herrscht, weil sich alle furchtbar schlecht informiert fühlen und voller Panik jede Verantwortung für eine erfolgreiche Einführung ablehnen, und einer dritten, in der alle erleichtert sind, dass es doch irgendwie einigermaßen geklappt hat. |
|
|
Daraus lässt sich als die entscheidende Herausforderung für das Change Management bei IT-Projekten ableiten: Entscheidend ist, rechtzeitig zu Beginn der zweiten Phase mit einem reichhaltigen und möglichst "operativen" Informations-, Schulungs- und Unterstützungsangebot bereitzustehen. Was wiederum voraussetzt, dass man sich von der freundlich-desinteressierten Stimmung der ersten Phase nicht einlullen lässt, sondern mit voller Kraft an der Vorbereitung entsprechender Angebote arbeitet. |
|
|
Das ist der einfachere Part: Diese Art des Lernens findet statt, indem man spätestens ab dem dritten Mal wiederkehrende Muster erkennt und daraus ableitet, auf welche für Neulinge überraschende Dynamik man gefasst sein muss. Und welche Vorgehensweise daher zweckmäßig ist, um in kritischen Phasen nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Dazu zählt auch, Erfahrungen mit unterschiedlichen Vorgehensweisen, Methoden und "Tools" zu sammeln und auszutesten, welches Vorgehen in welchem Kontext besonders wirksam ist. |
|
|
… und an persönlicher Reife gewinnen |
||
Der anspruchsvollere zweite Teil des Lernens ist – Persönlichkeitsentwicklung. Wenn es in einem Change-Projekt nicht nach Plan läuft (und manchmal auch bei anderen Gelegenheiten), kommt man als Change Manager ja auch als Person unter Druck: Erstens, weil man vielleicht überrascht und verwirrt von den unerwarteten Reaktionen ist, zweitens weil mit sich selbst und der eigenen Arbeit nicht zufrieden ist, drittens, weil man mehr oder weniger offen kritisiert und zum sofortigen Handeln gedrängt wird. In solchen Situationen kann man sich selbst dabei erleben und beobachten, wie man unter Stress agiert – und macht dabei vermutlich auch die eine oder andere Entdeckung, die einem unangenehm ist oder einen zumindest nicht besonders freut. |
|
|
Vielleicht wird einem nachträglich zum Beispiel im Rahmen einer Supervision bewusst, dass man in einer vor kurzem erlebten Situation "eigentlich" der Überzeugung war, das von der Geschäftsführung ins Auge gefasste Vorgehen sei nicht sinnvoll, dass man aber nicht den Mut hatte, dies auch auszusprechen, und die Geschäftsleitung stattdessen unwidersprochen tun ließ, was sie für richtig hielt. |
|
|
Sich an solche "schwachen Momente" zu erinnern, ist unangenehm, es erfordert daher Mut zur Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und ggf. gegenüber dem Coach und/oder der Supervisionsgruppe. Noch mehr Mut erfordert es, dieses Verhalten nicht zu rationalisieren, sprich, mit einer Pseudo-Begründung zu rechtfertigen. Nur indem man den Mut aufbringt, sich mit solchen Momenten des "Versagens" auseinandersetzen, gewinnt man die Chance, die Gründe für das eigene Handeln zu verstehen und Handlungsalternativen zu reflektieren. Und sich dann zum Beispiel zu entscheiden, künftig in ähnlich gelagerten Situationen mutiger zu agieren und der Geschäftsführung höflich, aber auch klar und deutlich zu widersprechen. Und diesen Vorsatz dann idealerweise auch umzusetzen. |
|
|
Auch dies ist ein Lernen aus Erfahrungen – aber ein anstrengenderes. Zwar geht es auch in diesem Fall letztlich nur darum, Muster zu erkennen, doch in diesem Fall geht es um Muster, die nicht mehr von äußeren Gegebenheiten wie der Dynamik bestimmter Change-Prozesse bestimmt sind, sondern von der eigenen Persönlichkeit: Muster, die mit unserer Persönlichkeit zu tun haben und von unseren Ängsten und Wunschvorstellungen geprägt sind. |
|
|
Dabei stößt man zwangsläufig auch auf Muster im eigenen Denken und Handeln, zu denen wir uns nicht so gerne bekennen – und zwar einfach deshalb nicht, weil sie nicht zu unserem "Ich-Ideal" passen, also zu dem Idealbild, das wir von uns selbst pflegen. Doch gerade dieses Lernen ist besonders wertvoll: Wer seine eigenen Denk- und Verhaltensmuster erkennt und sich mit ihnen auseinandersetzt, kann auf dieser Basis neue Weichenstellungen für sein künftiges Handeln vornehmen. In solchen Momenten entwickelt man sich als Persönlichkeit weiter: Man gewinnt an "Reife". |
|
|
Persönliche Weiterentwicklung |
||
Das ist eine weitaus größere und vor allem wertvollere Weiterentwicklung als, noch ein paar zusätzliche "Kunststücke" zu erlernen und sein Repertoire noch um einige weitere Methoden und Tools zu vergrößern. Aber es ist mühsamer. Dies ist nicht der breite, vielbegangene Weg, das ist der steile und steinige Pfad: Anstrengender zu gehen, aber man hebt sich damit von der breiten Masse ab, die zwar ordnerweise Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate vorweisen kann, sich aber um die lästige und teilweise schmerzhafte Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit gedrückt hat. |
|
|
Natürlich kann man theoretisch "das eine tun, ohne das andere zu lassen" – oder das zumindest von sich behaupten. Und natürlich wird niemand, der an seiner Persönlichkeitsentwicklung arbeitet, deswegen jede Beschäftigung mit interessanten neuen Methoden ablehnen. Umgekehrt bin ich skeptischer: Vielleicht irre ich mich ja, aber ich habe den Eindruck, dass viele die Jagd nach den neuesten Methoden auch als Alibi nutzen, um an ihre persönlichen Muster nicht heran zu müssen. Das ist keine Sünde: Es gibt ja keine Verpflichtung, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Es ist nur eine bedauerliche Selbstbeschränkung des eigenen Potenzials an einer Stelle, an der besonders viel "zu holen" ist. |
|
|
Anstrengend und zuweilen schmerzhaft ist diese Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit übrigens nicht, weil man sich dafür schinden und/oder von anderen quälen lassen müsste. Anstrengend ist sie vor allem, weil man Facetten seiner Persönlichkeit zur Kenntnis nehmen und sich zu ihnen bekennen muss, die einem nicht so gut gefallen oder vielleicht sogar peinlich sind. Solche Einsichten über sich selbst zuzulassen, statt sie zu verleugnen oder wegzureden, erfordert zwar etwas Mut und Selbstüberwindung, aber letztlich macht es einem das Leben leichter, weil es einen von der Last befreit, permanent einer Fiktion hinterherzulaufen. Zugleich eröffnet es uns die Möglichkeit, zu korrigieren, was wir korrigieren möchten, und zu akzeptieren, was wir nicht ändern wollen oder können. |
|
|
Der Volksmund hat in diesem Fall eindeutig recht: "Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung." Schon allein mit dem Mut, sich nicht nur über die anderen zu beklagen, sondern das eigene Handeln ins Blickfeld zu nehmen, und dabei auch bei unangenehmen Erkenntnissen genau hinzuschauen, hebt man sich von den vielen ab, die diese Selbstreflexion verweigern. Zumal man solche Erkenntnisse kaum haben kann, ohne etwas aus ihnen abzuleiten – was dann bereits der zweite Schritt zur Besserung ist. |
|
|
Empathie für sich selbst |
||
Was man sich dagegen schenken kann (und unbedingt schenken sollte!), ist, sich im Falle erkannter Schwächen selbst für diese "Charaktermängel" zu geißeln, zu tadeln oder als Feigling, Versager oder sonst etwas zu beschimpfen. Das ist nicht nur nutzlos, es ist schädlich: Damit macht man sich nur fertig, ohne dass es irgendeinen Nutzen bringt. Stattdessen baut man damit eine zusätzliche Lernbarriere auf. Denn wenn ich mir eine negative Eigenschaft (wie zum Beispiel Feigheit) attestiere, erkläre ich sie damit gedanklich zu einem festen, kaum beeinflussbaren Charaktermerkmal – und mache es mir auf diese Weise sehr schwer, an eine Veränderbarkeit zu glauben. |
|
|
Nein, wir sind keine Feiglinge, Versager und Hasenherzen, wenn wir nicht den Mut hatten, der Geschäftsführung spontan in den Arm zu fallen – wir haben nur das Gleiche getan wie alle anderen im Raum auch, nämlich, den Alphatieren nicht ohne Not zu widersprechen. Wir haben uns bedeckt gehalten wie alle anderen auch, und uns "nicht unnötig exponiert". Nicht sonderlich heldenhaft ohne Zweifel, aber auch kein unheilbares Charakterdefizit, einfach nur die ganz normale, geschäftsübliche Zurückhaltung: Man spricht halt nicht immer alles aus, was man sich denkt, weil man ja weiter miteinander auskommen muss und keinen Ärger will. |
|
|
Statt das eigene Schweigen nachträglich scharf zu missbilligen, ist es viel produktiver, sich selbst mit Verständnis, Wohlwollen und Empathie zu begegnen. Damit ist nicht gemeint, sein Verhalten schönzureden, und erst recht nicht, es im Nachhinein als das einzig Mögliche oder zumindest als das einzig Richtige darzustellen. Nein, ideal war das Verhalten eindeutig nicht, aber das bedeutet weder, dass wir unfähig wären, noch dass wir aus verwerflichen Motiven gehandelt hätten. Vielmehr sollten wir nicht nur bei anderen, sondern auch beim Umgang mit uns selbst davon ausgehen, dass wir das, was wir getan oder unterlassen haben, aus verständlichen und nachvollziehbaren Motiven gemacht haben. Auf dieser Basis fällt es viel leichter, den tieferen Gründen unseres Handelns nachzuspüren, als wenn wir uns innerlich verurteilen: Nur eine empathische Haltung macht es uns möglich zu erkennen, was genau uns eigentlich zu unserem Tun oder Unterlassen veranlasst hat. Das ist wichtig, denn nur wenn man die tieferen Gründe des eigenen Handelns versteht, kann man sie überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. |
|
|
Hier ist genau das gefragt, was der renommierte Konfliktforscher und Mediator William Ury "Empathie für sich selbst" nennt: Sich selbst und dem eigenen Handeln einfühlsam zu begegnen statt be- und verurteilend. Um die Gründe des eigenen Handelns besser zu verstehen, ist es nützlich, sich bewusst zu machen, dass jedes Verhalten das Resultat einer (bewussten, unbewussten oder halbbewussten) Wahl unter mehreren Alternativen ist. So gab es in unserem Beispiel etwa die Alternativen, zu schweigen oder zu widersprechen – und allerlei Abstufungen dazwischen, wie etwa, sehr dezidiert zu widersprechen, nur vorsichtige Andeutungen zu machen, gezielte Fragen zu stellen oder sonst etwas. Unter all diesen Alternativen haben wir genau diejenige gewählt, die uns am ehesten geeignet scheint, uns unseren Zielen näherzubringen (oder uns zumindest nicht weiter von ihnen zu entfernen). |
|
|
Das heißt aber, wir können aus der Alternative, die wir gewählt haben, auf unsere Ziele zurückschließen und erkennen, was in der gegebenen Situation unsere höchste Priorität war. Dazu ist es sinnvoll, sich sowohl mit der gewählten Handlungsalternative zu beschäftigen als auch mit denjenigen, die wir verworfen haben, und insbesondere mit derjenigen, die uns "eigentlich" als besser, richtiger, sinnvoller erschiene. Also im konkreten Fall mit der Alternative, der Geschäftsführung klar und deutlich zu widersprechen. Was hat uns davon abgehalten, dies zu tun? Was hätte passieren können, wenn wir es getan hätten? Was war unsere Sorge, was unsere Befürchtung? Aus welchen "vernünftigen" Gründen haben wir letztlich die Alternative vorgezogen, nichts zu sagen? |
|
|
Bei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen ist entscheidend, sich nicht selbst "in die Pfanne zu hauen", sondern einfühlsam und verständnisvoll den Motiven des eigenen Handelns nachzugehen: Sich um eine absolut ehrliche, aber wohlwollende und nicht verurteilende Antwort zu bemühen. "Weil ich zu feige war", ist keine Antwort, mit der etwas anzufangen ist – das ist eine Selbstgeißelung, die allenfalls zu der Folgerung führt: "Dann darf ich beim nächsten Mal eben nicht mehr so feige sein." Es mag gelingen, sich auf diese Weise selbst zur Tapferkeit zu zwingen; sehr erfolgversprechend ist es nicht, weil sich an den tieferen Gründen der vermeintlichen Feigheit durch solch einen heroischen Entschluss ja nichts ändert. Also wird eine ähnliche Wahl wahrscheinlich auch beim nächsten Mal am attraktivsten erscheinen. |
|
|
Sich selbst auf die Schliche kommen |
||
|
Am besten gelingt es, sich selbst auf die Schliche zu kommen, wenn wir ehrlich und neugierig, ohne innere Selbstverteidigungsreflexe den tieferen Motiven unseres Handelns nachspüren. Dann kommen wir mit einiger Wahrscheinlichkeit zu Erkenntnissen, die uns vermutlich nicht völlig neu sind, die wir uns so genau aber auch noch nie angesehen haben. Dabei helfen Fragen wie: Was hätte denn passieren können, wenn wir widersprochen hätten? Was genau haben wir befürchtet? Indem wir verschiedene Handlungsalternativen durchdenken, können wir austesten, wo eigentlich genau unsere Sorgen und Ängste liegen. |
|
|
Möglicherweise, so vielleicht der erste Gedanke, wäre die Geschäftsführung über unsere Einwände einfach hinweggegangen. Doch das allein kann nicht der Grund unseres Schweigens gewesen sein, denn dadurch hätte sich für uns nichts verschlechtert, außer, dass es uns vielleicht ein bisschen gekränkt hätte: Dann hätte die Geschäftsführung nur in Kenntnis unserer Einwände das Gleiche getan, was sie in deren Unkenntnis auch getan hat. Alles in allem also wohl nicht der entscheidende Grund, weshalb wir in Deckung geblieben sind. (Außer, Ihre innere Stimme sagt: Doch, genau das war es.) |
|
|
Vielleicht, so der nächste Gedanke, hätte die Geschäftsführung auch ärgerlich reagiert und uns einen Rüffel erteilt: Unangenehm gewiss und sicher nichts, was man unbedingt haben muss, aber auch keine existenzielle Katastrophe. Vielleicht ein Risiko, das man im Wiederholungsfall eingehen könnte, ohne zu viel aufs Spiel zu setzen. Deutlich unangenehmer wäre, wenn sie uns unseren Widerspruch dauerhaft übel nähme: Dann könnte es negative Konsequenzen für unsere Karriere bzw. für Folgeaufträge haben – schon eher ein Grund, vorsichtig zu sein. Aber dann müssten wir uns wohl früher oder später eh mit dem Gedanken auseinandersetzen, ob wir auf die Dauer für eine Firma oder einen Kunden arbeiten wollen, deren Chefs keinen Widerspruch dulden. |
|
|
|
Generell spielen für die Einschätzung des Risikos zwei Dinge eine Rolle: Zum einen die Frage, wie hoch wir in Kenntnis der konkreten Personen in der Geschäftsführung die Wahrscheinlichkeit einer solchen Reaktion einschätzen – und zum anderen, ob wir solch ein Risiko um jeden Preis vermeiden wollen. Denn eine hundertprozentige Garantie, dass keine negative Reaktion erfolgt, kann uns niemand geben – wer dieses Risiko also um jeden Preis vermeiden will, dem bleibt nur die Wahl, für immer zu schweigen. |
|
|
|
Falls Sie sich in keiner der angesprochenen Varianten spontan wiederfinden, haben Sie vielleicht ein ganz anderes Risiko gescheut: Es könnte ja auch passieren, dass die Geschäftsführung aufgeschlossen auf Ihre Einwände reagiert – und sie Sie fragt, was Sie denn stattdessen vorschlagen. Dann gäbe es wieder zwei Möglichkeiten: Möglicherweise hätten Sie dann keinen Alternativvorschlag, oder zumindest keinen, der ganz zu Ende gedacht ist und daher leicht "auseinanderzunehmen" ist. Dann stünden Sie als Bedenkenträger da, der selbst keine brauchbaren Ideen hat. Oder, vielleicht das noch größere Risiko, die Geschäftsleitung ließe sich von Ihrem Vorschlag überzeugen – und würde Sie mit dessen Umsetzung beauftragen. Dann hätten Sie plötzlich die Verantwortung an der Backe, dass Ihr Vorschlag auch funktioniert – und möglicherweise wäre Ihnen das ein bisschen zu heiß. |
|
|
|
Was der wirkliche Grund ist, kann jede/r nur für sich selbst beantworten. Sicher ist nur, dass es einen Grund geben muss, denn wir haben ja nicht aus Versehen so gehandelt wie wir gehandelt haben. Es dürfte aber deutlich geworden sein, dass sich aus unterschiedlichen Erklärungen auch ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und Ableitungen für das künftige Handeln ergeben: Wer Angst um seine Karriere oder um Folgeaufträge hat, muss sich mit ganz anderen Fragen auseinandersetzen als jemand, der vor allem vor der Verantwortung zurückschreckt, am Ende selbst für den weiteren Verlauf des Change-Prozesses verantwortlich zu sein, und sich deshalb mit Einwänden zurückhält. |
|
|
|
Verständnisvoller Umgang mit sich selbst |
||
|
Bei alledem ist ein wohlwollender Umgang mit sich selbst wichtig: Mit "Härte gegen sich selbst" kommt man nicht weiter – das ist ein Rezept aus der alten, brachialen Schule "Gelobt sei, was hart macht", dessen Untauglichkeit vielfach erwiesen ist. Auch beim Umgang mit sich selbst und der persönlichen Weiterentwicklung geht es nur mit Empathie und Verständnis für sich selbst. Das heißt vor allem, sich und sein Handeln nicht vorschnell zu verurteilen oder negativ zu etikettieren: Keines der oben genannten Motive ist eines, wofür man sich schämen müsste – sie sind einfach da und müssen mit Einfühlung in sich selbst durchdacht werden. Und jede/r muss dafür die Antwort finden, die zu ihr oder ihm passt. Gleich wohin es führt. Je besser man sich selbst und seine Beweggründe versteht, desto leichter wird es, neue Entscheidungen zu treffen, die dann auch unter Stress Bestand haben. |
|
|
|
Bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es nicht ausschließlich um die Themen Mut bzw. Angst, auch wenn das aus guten Gründen Dauerbrenner sind. Im Grunde kann bei der Selbstreflexion alles Thema sein, was im Rückblick nicht optimal gelaufen ist oder wovon eine Irritation, ein "Störgefühl" zurückgeblieben ist: Alles, was dem eigenen Empfinden nach von Bedeutung ist, verdient es, intensiver ins Blickfeld genommen zu werden. Desgleichen, wenn wir nicht sicher sind, ob wir in einer Situation richtig reagiert haben, ob wir zum Beispiel zu harsch oder zu ungeduldig waren: Das eigene Gefühl, welches Thema vertiefter Aufmerksamkeit bedarf, ist der beste Indikator dafür, womit man sich beschäftigen sollte oder könnte. |
|
|
Noch ein Stück schwieriger ist vielleicht die Analyse von gelungenen, erfolgreichen Interventionen. Denn Aufmerksamkeit verdient ja nicht nur das, was nicht optimal gelaufen ist, sondern auch das, was gut gelaufen ist – oder vielleicht sogar optimal. Aber Menschen haben auch unterschiedliche Muster, mit Erfolgen umzugehen: Manche sind einfach nur erleichtert, dass es gut gegangen ist, andere sind stolz wie Oskar und schweben ein paar Tage lang auf Wolken, wieder andere bemerken Erfolge kaum, weil sie ja das sind, was sie von sich erwarten. Nur seine Erfolge systematisch untersuchen, das macht kaum jemand. Warum eigentlich nicht? |
|
|
Falsche Balance vermeiden |
||
Wenn man sich nur mit den Dingen ausführlicher beschäftigt, die nicht optimal gelaufen sind, erfolgreiche Interventionen dagegen erfreut, aber nur kurz zur Kenntnis nimmt, erzeugt man ungewollt eine falsche Balance: Auf diese Weise richten sich 80 oder gar 98 Prozent der Aufmerksamkeit auf Dinge, die unbefriedigend oder zumindest nicht voll zufriedenstellend verlaufen sind. Was in Summe fast unweigerlich den Eindruck hinterlässt, als liefe das Change-Projekt insgesamt ziemlich schlecht. Auf diese Weise entsteht ein schiefes Bild, das sowohl dem Image des Projekts abträglich sein als auch das eigene Selbstvertrauen beeinträchtigen kann. |
|
|
Zwar halte ich es im Gegensatz zu Verfechtern einer radikalen Stärkenorientierung keineswegs für schädlich und erst recht nicht für "gefährlich", sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht optimal gelaufen sind – im Gegenteil, ich finde es ausgesprochen wichtig, sich mit solchen Erfahrungen bewusst auseinanderzusetzen (zumal sich unser Unbewusstes sowieso mit ihnen beschäftigt). Ich teile aber die Skepsis gegenüber einer einseitigen Defizitorientierung. Denn sie erweckt ungewollt den falschen und irreführenden Eindruck, man stolpere bei seiner Arbeit eigentlich von Fehler zu Fehler. |
|
|
Aber, so das vordergründige Problem, was gibt es über Erfolge schon groß zu sagen? Ja, der Workshop, die Veranstaltung, das Meeting mit dem Vorstand ist ziemlich gut gelaufen, und, ja klar, und das ist natürlich sehr erfreulich – aber was noch? Auch gestandene Change Manager haben oft Mühe mit der Frage: Was habe ich da eigentlich richtig gemacht – bei dem Ereignis selbst, aber vielleicht auch im Vorfeld und bei der Vorbereitung? Welche meiner Aktivitäten, Eigenschaften, Fähigkeiten, Stärken haben zu dem Erfolg beigetragen? Wie habe ich das eigentlich hinbekommen, was konkret waren wesentliche Erfolgsfaktoren? Was davon würde ich beim nächsten Mal wieder genau so machen, was vielleicht trotz des Erfolgs nicht? |
|
|
Das kann so weit gehen, dass man seine Stärken gar nicht wahrnimmt, weil sie einem so selbstverständlich erscheinen, dass man es sich gar nicht anders vorstellen kann. Möglicherweise kennen Sie das auch von sich selbst: Bemerken Sie manchmal erst bei der Beobachtung anderer, wie viele Facetten der Realität sie gar nicht wahrnehmen, die für Sie offensichtlich sind? Und mit welcher intuitiven Sicherheit Sie manche Dinge punktgenau richtig machen, die andere mit weniger einschlägiger Erfahrung viel ungeschickter angehen? |
|
|
Falls ja, zählen Sie vermutlich auch zu denen, die ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken nicht oder nur unvollständig wahrnehmen. Und sich manchmal im Stillen fragen, was an dem, was Sie tun, eigentlich so Besonderes ist, das überhaupt der Erwähnung (und Vergütung) wert ist. Es ist ausgesprochen nützlich, solche der eigenen Sicht bislang verborgenen Stärken besser zu erkennen – nicht nur für das Selbstwertgefühl, sondern auch, um seine eigenen relativen Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen klarer zu sehen und sie, falls nötig, auch offensiver und prägnanter vermarkten zu können. |
|
|
Die Qualität des eigenen Beitrags einschätzen |
||
Andererseits gehört zur Wahrheit auch, dass nicht alles, was gut gelaufen ist, allein auf unser geniales Wirken zurückzuführen ist. Manchmal haben wir einfach nur Glück gehabt, und/oder der Zufall oder die inhärente Dynamik der sozialen Situation kam uns zu Hilfe. Das festzustellen, heißt nicht, die eigene Leistung zu entwerten oder unsere Erfolge in falscher Bescheidenheit auf günstige Umstände zurückzuführen; es trägt einfach der Tatsache Rechnung, dass wir in sozialen Situationen nie die hundertprozentige Kontrolle über das Geschehen haben. Und zwar einfach deshalb nicht, weil auch alle anderen Akteure Einfluss darauf nehmen, wie sich die Situation entwickelt und was dabei herauskommt. |
|
|
Auch wenn wir alles ziemlich optimal machen, entscheiden letztlich die anderen Beteiligten, wie sie auf unsere Impulse reagieren – und damit auch darüber, wie der gesamte Prozess weitergeht. Was in der Praxis auch heißen kann: Auch bei einem optimalen Vorgehen kann es vorkommen, dass sich die Situation nicht in der gewünschten Weise entwickelt. Wir haben nie die alleinige Kontrolle: Wir können immer nur unseren bestmöglichen Beitrag leisten. Deshalb sollten wir letztlich auch nicht so allein den Erfolg zum Maßstab machen, sondern uns stattdessen immer fragen: Haben wir unseren bestmöglichen Beitrag zu einem erfolgreichen Verlauf geleistet? |
|
|
Das wird manchen nicht gefallen, für die letztlich nur "Resultate" zählen. Sie haben damit insofern recht, als dies tatsächlich das Einzige ist, was für das Geschäftsergebnis relevant ist. Trotzdem ist der bloße Erfolg ein Maßstab, mit dem für die eigene Weiterentwicklung wenig anzufangen ist. Denn wenn es um Entwicklung geht, müssen wir daran orientieren, was wir beeinflussen können – und direkt beeinflussen können wir eben nur unser eigenes Denken und Handeln; alles andere und auch die Resultate beeinflussen wir damit nur indirekt, und wir sind, wie wir gerade festgestellt haben, nicht der Einzige, der auf die Ergebnisse Einfluss nimmt. |
|
|
Bei der eigenen Weiterentwicklung ist es daher sinnvoll, sich vom Erfolg als primärem Maßstab zu lösen. Natürlich ist es schön und "belohnend", wenn eine Intervention erfolgreich war. Doch auch wenn eine Intervention sehr erfolgreich war, kann es sein, dass wir keineswegs unseren bestmöglichen Beitrag geleistet haben. Vielleicht haben wir auch einfach nur Glück gehabt, vielleicht haben wir sogar ziemlich ungeschickt agiert, aber es sind uns andere zu Hilfe gekommen und haben unseren Patzer ausgebügelt. Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass wir unser Bestmögliches getan haben, die Situation insgesamt aber dennoch nicht optimal verlaufen ist. |
|
|
Würden wir allein den Erfolg zum Maßstab machen, liefen wir in beiden Fällen Gefahr, das Falsche aus unseren Erfahrungen zu lernen. Wenn die Sache gut ausgegangen ist, liegt der Fehlschluss nahe, dass wir alles richtig gemacht hätten und daher beim nächsten Mal bloß wieder genauso machen müssen. Im Falle eines Misserfolgs drängt sich der Schluss auf, dass wir unseren Fehler erkennen und uns für das nächste Mal etwas anderes einfallen lassen müssen. Das kann richtig sein, aber der Schluss ist nicht zwingend. Vielleicht müssen wir auch einfach einsehen, dass ein stärkerer Einfluss als unser eigener gegen unsere Intervention gewirkt hat – und dass das gewählte Vorgehen vielleicht trotzdem die beste Strategie ist, die uns in dieser Situation zu Verfügung stand. |
|
|
Der Fokus für die persönliche Weiterentwicklung muss daher das eigene Denken und Handeln sein: Haben wir nach bestem Wissen und Gewissen unser Bestmögliches getan? Zugleich ist bei Change-Prozessen immer auch ein Schuss Demut angebracht: Gleich wie viel reflektierte Erfahrung wir mitbringen, was herauskommt, wird eben nicht allein von unserem Handeln bestimmt. Manchmal führt auch ein unbedachtes Vorgehen zu sehr guten Ergebnissen (oder verhindert sie zumindest nicht), umgekehrt birgt auch ein sehr kluges und durchdachtes Vorgehen keine absolute Erfolgsgarantie. Letztlich hantieren wir eben mit Wahrscheinlichkeiten und nicht mit deterministischen Systemen. |
|
|
Mut zur Unvollkommenheit |
||
Wer auf diese Weise mit einer gewissen Beharrlichkeit an sich bzw. seiner Persönlichkeit arbeitet, wird nach meiner Erfahrung drei bemerkenswerte Feststellungen machen. Die erste ist: Es ist gar nicht so schlimm, wie vielleicht befürchtet. Das anfängliche Bauchgrimmen lässt bald nach; fast ohne es zu bemerken, entwickelt man mehr "Mut zur Unvollkommenheit", wie es die frühe Individualpsychologin Sophie Lazarsfeld (1881 – 1976) brillant auf den Punkt gebracht hat: Man löst sich allmählich von dem inneren Glaubenssatz, dass man als Change Manager perfekt sein und seine Unzulänglichkeiten daher vor den anderen verbergen müsse. |
|
|
Es ist fast wie bei Wilhelm Busch: "Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert." Hat man sich erst einmal davon gelöst, sich und anderen Perfektion vorspielen oder vorspiegeln zu wollen, und damit begonnen, sich zu seiner Fehlbarkeit und zu bestimmten Unzulänglichkeiten zu bekennen, merkt man, welcher Druck von einem abfällt. Ab dann beginnt man wirklich, "ungeniert" zu leben, sprich, ohne einem unerfüllbaren Ideal hinterherzulaufen. Das heißt keineswegs, dass man dann Fünfe gerade sein lässt, weil einem die Qualität seiner Arbeit dann gleichgültig wäre – im Gegenteil: Das Bestreben, optimale Arbeit zu machen, fällt leichter, wenn man sich von dem unerfüllbaren Perfektionsdruck befreit. |
|
|
Nach meiner eigenen Erfahrung geht das nicht ganz ohne "Rückfälle" ab: Ab und zu fällt man doch wieder in die antrainierten Denk- und Verhaltensmuster zurück. Aber schrittweise und allmählich lernt man, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass man fehlerlos sein müsste, ihr vielleicht sogar aktiv entgegenzutreten, indem man sich "freiwillig" zu seiner Unvollkommenheit bekennt. Und zu seiner Überraschung erlebt man dann, dass man dadurch keineswegs an Respekt verliert – manche sind vielleicht sogar erleichtert, weil man "lockerer" geworden ist und Fehler zugeben kann. Und zwar einfach, weil sie selbst dann auch weniger unter dem Druck stehen, sich und anderen Perfektionismus vorzuspielen. |
|
|
Die anfängliche Hürde, über eigene Fehler und Unzulänglichkeiten zu reden, wird immer niedriger, bis sie ganz verschwindet. Was am Anfang eine echte Überwindung war und ziemlich stressig noch dazu, wird immer normaler. Allmählich freut man sich sogar auf die Bereicherung, die man aus dem Kennenlernen anderer Perspektiven gewinnt. Spätestens dann merkt man wahrscheinlich, dass der "steinige Weg" gar nicht so anstrengend ist und schon gar keine furchtbare Quälerei, dass er im Gegenteil so manche Aussicht (und Einsicht) bietet, der auf der breiten Straße der bloßen Methodenhuberei kaum zu gewinnen wäre. |
|
|
Volle Konzentration auf die Sache statt Selbstbezogenheit |
||
|
Ziemlich bald schlägt sich das zum zweiten auch in der Produktivität bzw. in der eigenen Wirksamkeit als Change Manager nieder. Denn indem man neue Perspektiven gewinnt, wird unverständliches und scheinbar irrationales Verhalten anderer Akteure plötzlich verständlicher – und das heißt zugleich auch: Man gewinnt neue Ansatzpunkte, um konstruktiv und gestaltend mit "unerwünschtem Verhalten" umzugehen, statt es bloß zu ignorieren oder zu bekämpfen. |
|
|
Das kann praktisch zum Bespiel heißen: Wo man früher in der Gefahr war, sich in fruchtlose Machtkämpfe zu verstricken, um die vermeintlichen Bremser und Blockierer gegen ihren Widerstand auf Kurs zu zwingen, gelingt es einem jetzt vielleicht, sich in ihre Sorgen und Befürchtungen einzufühlen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und die Betreffenden so für das übergeordnete Vorhaben zu gewinnen, ohne dass ein Kampf erforderlich wird. |
|
|
|
Dabei geht es nicht um Alles oder Nichts: Selbst wenn das nicht in jedem Einzelfall gelingt, reduziert es in jedem Fall, wo es gelingt, doch die Zahl der Fälle, in denen es zu einer Konfrontation oder zu verdeckten Widerständen kommt. Damit reduziert es zugleich auch die Zahl der Gegner des Veränderungsvorhabens, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, es in Schwierigkeiten zu bringen oder scheitern zu lassen. |
|
|
|
Zum anderen wird man paradoxerweise auch dadurch effektiver, dass man gelassener wird, weil man weniger mit sich selbst und der eigenen Performance beschäftigt ist. Das schafft den Raum dafür, sich in aller Konsequenz auf die Sache zu konzentrieren. Je stärker jemand um die eigene Wirkung und Reputation besorgt ist, desto mehr ist sie oder er auch versucht, bestimmte Dinge genau aus diesen Motiven heraus zu tun oder zu unterlassen. Wirklich wichtig ist aber alleine die Frage, was am besten geeignet ist, das Vorhaben in der Sache weiterzubringen. |
|
|
Solange man zum Beispiel innerlich unter dem Druck steht, Widerstand irgendwie beseitigen oder gar "brechen" zu müssen, ist man kaum bereit und in der Lage, den Skeptikern oder Gegnern eines Change-Vorhabens aufmerksam und geduldig zuzuhören, ist. Also ist man immer in der Gefahr, vorschnell gegen ihre Einwände und Bedenken zu argumentieren, ohne wirklich verstanden zu haben, was die Ängste oder Bedenken sind. Das geht in aller Regel schief: Das Gespräch wird schwieriger, die Positionen verhärten sich, und schließlich geht man als Gegner auseinander. |
|
|
Hat man dagegen die innere Gelassenheit, zuzuhören, gleich wohin es führt, bis die Skeptiker oder Gegner sich wirklich verstanden fühlen, kann man danach in aller Ruhe schauen, wie Lösungen aussehen könnten, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden. Dabei kann man sich an den renommierten Konfliktforscher Marshal B. Rosenberg halten, der die Überzeugung vertreten hat: "Wenn die wirklichen Bedürfnisse der Beteiligten auf dem Tisch sind, dauert es maximal noch 20 Minuten bis zu einer Lösung." |
|
|
Der "Mut zur Unvollkommenheit" reduziert Ichhaftigkeit und steigert genau dadurch die Effektivität. Er macht es möglich, die eigenen selbstbezogenen Bedürfnisse zeitweilig zurückzustellen und sich voll darauf zu fokussieren, was die Situation verlangt und was am besten dazu geeignet ist, sie in einem positiven, konstruktiven Sinne weiterzuentwickeln. Auf diese Weise kann man, in den Worten von Theo Schoenaker, "statt danach zu streben, der Beste zu sein, mutig und unvollkommen sein Bestes geben". |
|
|
Sich selbst besser steuern können |
||
Ein weiterer Nutzeffekt kommt hinzu: Je besser man sich selbst kennenlernt, desto besser ist man auch dazu in der Lage, die eigenen spontanen Reaktionen zu reflektieren und, wenn nötig, nachzujustieren – nicht nur in der relativ entspannten Situation der Supervision, sondern auch unter dem Stress der Realsituation. Beispielsweise weiß man nach einer Weile von sich, auf welche Auslöser, Verhaltensweisen oder Provokationen man besonders heftig anspringt (oder auch besonders schwach), wo man also zu Überreaktionen oder auch zu "Unterreaktionen" neigt. |
|
|
Solche persönlichen Muster werden wir zwar in der Regel nicht völlig los, aber wir können sie, wenn wir sie kennen, bemerken und korrigieren – und zwar auf der Stelle, nicht erst im Nachhinein. Beispielsweise neigen viele dominante Menschen dazu, sehr schnell eine klare Meinung zu haben und sie auch sehr dezidiert zu äußern. Damit können sie weniger selbstsichere Personen leicht verunsichern oder sogar entmutigen, ganz besonders, wenn sie in einer höheren Hierarchieposition sind. Mit der möglichen Folge, dass die Betreffenden dann erschrecken, ihre eigene Meinung für sich behalten und möglicherweise dauerhaft demotiviert sind. |
|
|
Wer so gestrickt ist, wird diese Dominanz wahrscheinlich nicht völlig ablegen können – und dies vermutlich auch nicht wollen, weil sie erstens Teil der eigenen Persönlichkeit ist und zweitens in vieler Hinsicht auch eine Stärke. Aber er oder sie kann sich der unerwünschten "Nebenwirkungen" dieses Persönlichkeitsmerkmals bewusst sein und sich deshalb in bestimmten Situationen dafür entscheiden, seine Dominanz bewusst zu zügeln, um eine ungewollte Einschüchterung und Demotivation von weniger selbstsicheren Personen zu vermeiden. |
|
|
Ebenso wird er es schneller wahrnehmen, wenn er jemandem anderen in spontaner Dominanz über den Mund gefahren ist, und er kann es korrigieren, bevor sich die negative Wirkung verfestigt: "Entschuldigung, vielleicht habe ich da jetzt zu schnell geschossen. Ich habe den Eindruck, Sie sehen es anders …" Auf diese oder ähnliche Weise lassen sich unerwünschte Effekte eigener Persönlichkeitsmuster und Verhaltenstendenzen "einfangen", wenn man sie erst einmal erkannt hat, und zwar ohne dass man den (in aller Regel vergeblichen) Versuch machen muss, ein anderer Mensch zu werden. |
|
|
Das reicht für die allermeisten Zwecke aus – auch bei Persönlichkeitsmustern und Verhaltenstendenzen, die man nicht in ein oder zwei Sätzen beschreiben kann, weil sie komplexer sind und oftmals auch mehr von der eigenen Biographie geprägt sind als spontane Dominanz. Immer geht es dabei um den Dreischritt:
Vor allem am Anfang ist dafür die Reflexion durch andere unverzichtbar, am besten durch eine Supervisionsgruppe, später ist man dazu oftmals auch im Alleingang in der Lage – auch wenn einige regelmäßige Selbstreflexion in der Gruppe weiterhin wertvoll bleibt. |
|
|
Abgeschlossen ist Persönlichkeitsentwicklung vom Grundsatz her niemals, einfach weil persönliche Weiterentwicklung möglich und lohnend ist, solange man lebt. (Also auch nach der Pensionierung.) Aus einer praktischen und pragmatischen Perspektive ist aber wichtig hinzuzufügen: Der Nutzen dieser Bemühungen setzt relativ schnell ein, und zwar einfach deshalb, weil man in der Supervision ja mit den Persönlichkeitsmustern beginnt, bei denen man am häufigsten ins Schleudern kommt bzw. die größte Reibung mit seiner Umgebung aufweist. Sind die zwei, drei größten Reibungspunkte einmal erkannt und entschärft, tut man sich schon wesentlich leichter und wird zugleich als Change Manager deutlich effektiver. Der "Rest" ist eine immerwährende Verfeinerung, die man in unterschiedlicher Intensität betreiben kann und darf. |
|
|
© 2022 Winfried Berner – vollständige oder auszugsweise Wiedergabe, gleich in welcher Form, honorarpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung / Zitate im üblichen Umfang mit Quellenangabe gemäß wiss. Zitationsregeln zulässig. Näheres siehe Nutzungsbedingungen. |
||
|