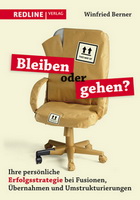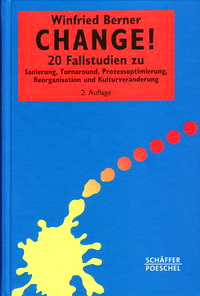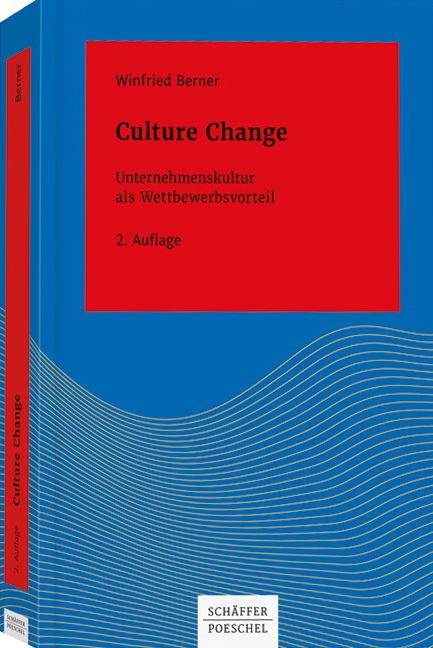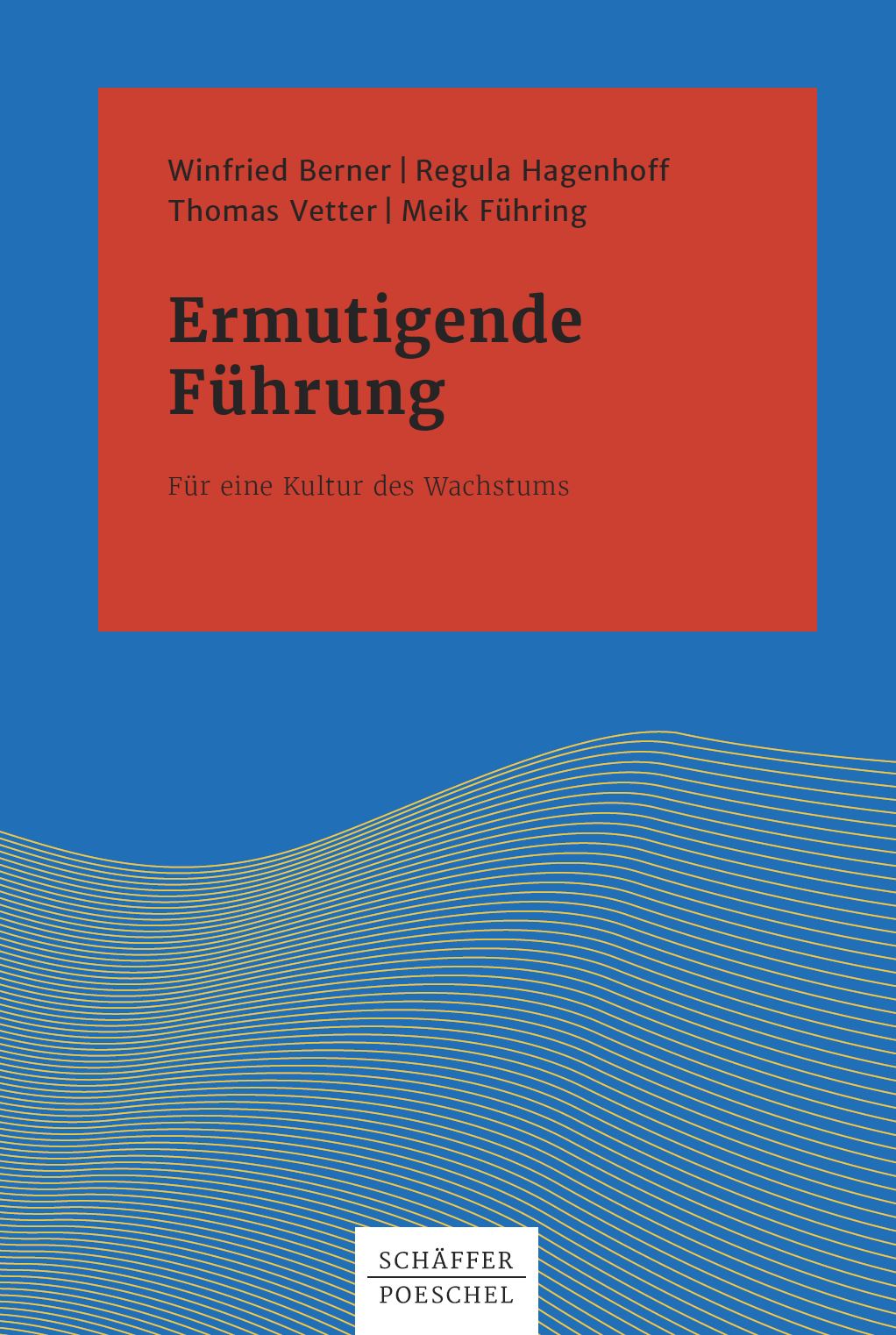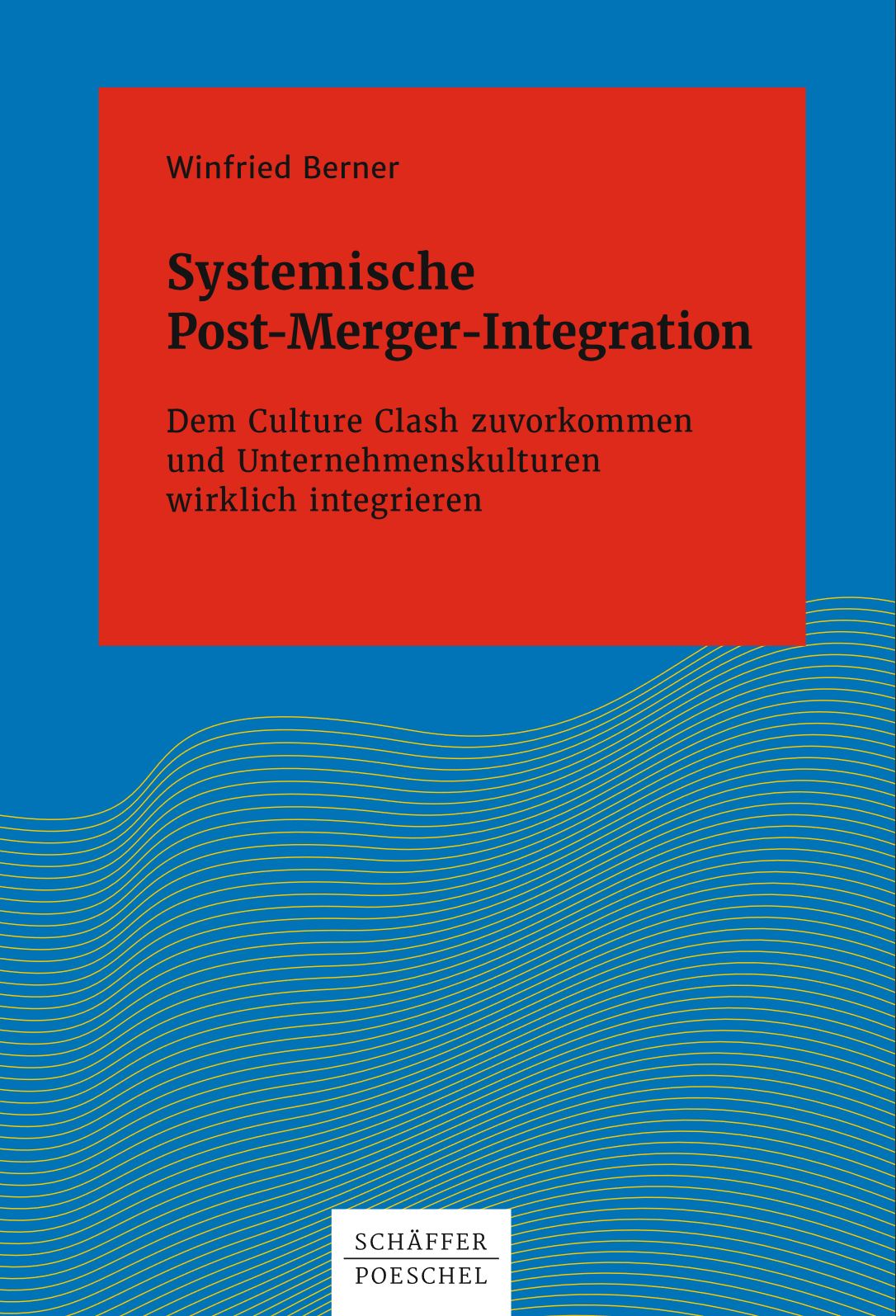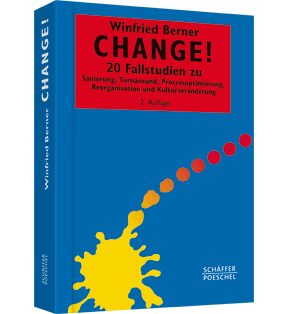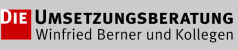
Die Rolle der Geschäftsleitung
|
||||||||||||||||||||
Machtmissbrauch: Von destruktiver und von konstruktiver Macht |
||||
|
Beim Thema Macht denken viele Menschen zuerst an Machtmissbrauch – manche mit Beispielen aus Politik und Geschichte im Hinterkopf, manche in Erinnerung an eigene schlechte Erfahrungen. In der Tat kann Macht benutzt werden, um sich ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen, um hemmungslose Ego-Trips auszuleben, um Gegner zu vernichten und Kritik und unerwünschte Meinungen zu unterdrücken. Dennoch ist Macht – gleich ob in Unternehmen oder in der Politik – unverzichtbar, um Veränderungen durchzusetzen, die im übergeordneten Interesse notwendig sind, aber nicht den Beifall aller Betroffenen und Interessengruppen finden. |
||||
|
Je wirkungsvoller ein Instrument, desto größer ist prinzipiell auch der Schaden, den man mit ihm anrichten kann. Eine Motorsäge ist gefährlicher als ein Fuchsschwanz, ein Bagger gefährlicher als eine Schaufel, ein Computer gefährlicher als ein Rechenschieber. Dennoch sind es nicht die Instrumente, von denen die Gefahr ausgeht, sondern die Menschen, die sich ihrer bedienen – genauer, die Einstellung ("Gesinnung"), aus der heraus sie handeln, sowie die Absichten und Ziele, die sie verfolgen. |
|
|||
Macht und Persönlichkeit |
||||
|
Unbestreitbar zieht Macht bestimmte Persönlichkeitsstrukturen besonders an. Wie Alfred Adler (1870 – 1937), der Begründer der Individualpsychologie, schon vor rund 100 Jahren erkannt hat, eignet sich Macht hervorragend, um Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren (bzw. sie überzukompensieren). Je mehr sich jemand unterlegen, "klein" und minderwertig fühlt, desto stärker sein Streben nach Überlegenheit. Dieses Bedürfnis kann auf verschiedene Arten ausgelebt werden: zum Beispiel durch Besserwisserei, durch "moralische Überlegenheit" – oder eben durch Macht. Insofern kann man die Neigung einer Führungskraft, andere Menschen klein zu machen oder zu schikanieren, durchaus als Selbstauskunft verstehen. |
|
|||
|
Kennzeichen für solche neurotischen Muster ist, dass sie immer eine gegen andere Menschen gerichtete Absicht enthalten: Sie zielen darauf, sich selbst zu erhöhen, indem sie andere erniedrigen. Zum Beispiel auf intellektuellem Gebiet ("Wie kann man nur so blöd sein?!") oder auf moralischem, indem sie anderen ein schlechtes Gewissen machen oder sie als selbstsüchtig, rücksichtslos oder ähnliches darstellen. Oder aber sie erniedigen sie auf praktischem Gebiet, indem sie sie ihre Unterlegenheit spüren lassen und sie zwingen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Zu etwas gezwungen zu werden, ist für andere Menschen besonders bedrohlich, deshalb ist die Angst vor Machtmissbrauch größer als die vor Klugscheißerei und Bigotterie. |
|
|||
|
Doch in der Geschichte der Menschheit gibt es keine Beispiele dafür, dass wegen der bestehenden oder befürchteten Risiken auf vorhandene Möglichkeiten verzichtet worden ist. Auch Machtmissbrauch ist nicht durch eine Dämonisierung der Macht zu verhindern oder einzudämmen. Eher trifft das Gegenteil zu: Die Dämonisierung und Tabuisierung der Macht schafft zusätzliche Freiräume für Missbrauch – und zieht erst recht genau die falschen Leute an. |
|
|||
Kontrolle der Macht |
||||
|
Deshalb ist es notwendig, dass wir uns dem "Phänomen Macht" stellen. Wenn wir ihm nicht ohnmächtig ausgeliefert sein wollen, müssen wir es verstehen und so weit wie möglich für sinnvolle Ziele nutzbar machen; zugleich sollten wir uns bemühen, seinem Missbrauch oder exzessivem Gebrauch durch wirksame Regeln einen Riegel vorzuschieben. (Was letztlich übrigens auch eine Form von Machtausübung ist.) |
|
|||
|
In demokratischen Strukturen erfolgt dieses "Zähmen" der Macht durch regelmäßige Wahlen. Alle paar Jahre haben die Wähler die Möglichkeit zu beurteilen, ob sie den Umgang der Regierenden mit ihrer Macht insgesamt angemessen und konstruktiv finden oder nicht. (Ob und in welchem Umfang sie davon Gebrauch machen, steht auf einem anderen Blatt.) Das funktioniert nicht perfekt, aber man kann auch nicht ernsthaft behaupten, dass es überhaupt nicht funktionierte. Es können sich sogar neue Parteien bilden und in die Parlamente einziehen, wenn eine ausreichende Zahl von Wählern der Meinung ist, dass die "Altparteien" mit ihrer Macht nicht gut umgehen. Wer noch mehr tun will, kann sich auf regionaler oder überregionaler Ebene in die Politik einmischen, sei es über die Mitarbeit in Parteien und Verbänden oder auf andere Weise. |
|
|||
In Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen existiert diese demokratische Form der Kontrolle nicht. Die vorhandenen Aufsichtsgremien üben zwar eine gewisse Kontrolle der Macht aus, allerdings primär aus Sicht der Anteilseigner und des Kapitalmarkts. Im Geltungsbereich deutschen (und österreichischen) Rechts hat zudem der Betriebsrat eine Kontrollfunktion, was die sozialen Belange der Belegschaft anbetrifft. Eine nicht zu unterschätzende zusätzliche Kontrolle ergibt sich de facto aus der Freiheit der Mitarbeiter, das Unternehmen zu verlassen. Denn der Macht eines Unternehmens kann man sich sehr viel leichter entziehen als der des Staates. Das gilt auch dann, wenn dieses Sich-Entziehen einen persönlichen Preis hat und vielen Mitarbeitern die Entscheidung, ob sie bleiben oder gehen sollen, nicht leicht fällt. |
||||
|
Dieses Korrektiv ist auch dann wirksam, wenn aufgrund der Arbeitsmarktlage, des Alters und der persönlichen Wettbewerbsfähigkeit längst nicht alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben zu gehen. Zumindest die besten und leistungsstärksten Mitarbeiter haben allemal genügend Alternativen. Wenn aber die Leistungsträger abwandern, weil sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht länger arbeiten wollen, hat das einen erheblichen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens insgesamt – und damit auf die "Überlebenschancen" der Unternehmensleitung. Die Abwanderung von Leistungsträgern übt daher starken Handlungsdruck auf das Management aus, erst recht, wenn sie erkennbar zunimmt. |
|
|||
|
||||
Konstruktive Machtausübung |
||||
|
Ob Macht konstruktiv oder destruktiv wirkt, hängt entscheidend davon ab, wie sie eingesetzt wird. Der wesentliche Unterschied liegt hier, wie der Individualpsychologen Fritz Künkel (1889 – 1956) glasklar unterschieden hat, darin, ob sie "sachbezogen" oder "ichhaft" eingesetzt wird. "Sachbezogen" ist der Einsatz von Macht dann, wenn die dahinter stehende Absicht gemeinschaftsfördernd ist, also etwa, wenn es darum geht, die gemeinsame Sache voranzubringen, etwas Neues aufzubauen, Ideen zu verwirklichen, aber auch, etwas Wertvolles zu verteidigen. "Ichhaft" ist der Einsatz von Macht immer dann, wenn die Intention gegen die Gemeinschaft gerichtet ist – wenn sie also etwa benutzt wird, um sich über andere zu stellen, andere klein zu machen, Wertvolles zu zerstören. Rupert Lay spricht in diesem Zusammenhang von "biophilem" bzw. "nekrophilem" Handeln: Ist das Handeln der "Machthaber" darauf gerichtet, menschliches Leben und Wachstum zu mehren oder es zu mindern? |
|
|||
|
Die Umgebung spürt diesen Unterschied sofort und reagiert darauf. Konstruktive Machtausübung wird oftmals kaum wahrgenommen, oder sie wird als eine "wohlwollend ordnende Hand" empfunden und begrüßt. Der entwertende Charakter der ichhaften Machtausübung hingegen polarisiert Unternehmen. Manche gehen in den Widerstand, andere wandern früher oder später ab, wieder andere wählen die Rolle des Opfers und leiden (mehr oder weniger) still vor sich hin, ohne Konsequenzen zu ziehen. Manche machen sich lustvoll und oft mit Zügen von Sadismus zu Schergen des Systems oder des willkürlichen Herrschers. (Was Anna Freud "Identifikation mit dem Aggressor" genannt hat.) |
|
|||
|
Dieser große Unterschied rührt daher, dass konstruktive Machtausübung ohne Demütigungen und (weitestgehend) ohne spektakuläre Siege auskommt – und damit auch weitgehend ohne "Verlierer". Ihre zentrale Intention besteht nicht darin, die eigene Großartigkeit zu beweisen, sondern darin, Dinge zu bewegen. Deshalb genügt es ihr völlig, die Weichen auf unspektakuläre Weise richtig zu stellen und Energie in die richtige Richtung zu mobilisieren. Der spektakuläre "Showdown" bleibt daher bei konstruktiver Machtausübung die krasse Ausnahme; im Normalfall läuft die Durchsetzung unspektakulär beinahe unauffällig ab. Da wird in Einzelgesprächen, Meeting und Reden Überzeugungsarbeit geleistet; Kompromissbereitschaft im Detail paart sich mit Klarheit der großen Linie, und nach einer Weile bildet sich ein breiter Zielkonsens heraus, dem sich diejenigen, denen das alles eigentlich gar nicht so recht ist, kaum noch entziehen können. |
|
|||
|
Die Machtausübung läuft hier oft so unauffällig ab, dass ungeübte Beobachter den Einsatz konstruktiver Macht kaum bemerken. Der leise Zwang resultiert letztlich aus der stillen Einsicht der "Andersgläubigen", dass die Sache entschieden ist und es keinen großen Sinn mehr hat, dagegen anzukämpfen. Weil kein Kampf stattfindet, erleidet auch niemand eine Niederlage; stattdessen entsteht ein Konsens, der vielleicht am Anfang noch von einigen Vorbehalten geprägt ist. Machtbewusst zu denken, heißt diese Vorbehalte zu erkennen, auch ohne dass sie ausgesprochen wurden, und zu versuchen, sie durch Kommunikation, Einbeziehung und durch Fordern, also durch das Abverlangen eigener Beiträge, aufzulösen. |
|
|||
Vorausschauend gestalten statt selbstbezogen demütigen |
||||
|
Konstruktiv machtbewusst zu denken, heißt auch, sich bewusst zu sein, dass die große Zeit der "Gegenreformation" und damit der Widerstand erst bei der ersten Krise kommen wird, und sich darauf in doppelter Weise vorzubereiten: Zum einen dadurch, dass man frühzeitig für greifbare Resultate sorgt, zum anderen dadurch, dass man in der Krise deutlich macht, dass das Projekt nach wie vor die volle Unterstützung des Top-Managements hat und dass ein Nachlassen, geschweige denn ein "Abschuss" des Projekts überhaupt nicht zur Diskussion steht. Auch hier findet die "Machtpolitik" nicht durch spektakuläre Kämpfe statt, sondern durch kluges Gestalten von Prozessen und durch das frühzeitige Setzen klarer Signalen – also letztlich durch Konfliktprävention. |
|
|||
|
Und auch hier merken naive Beobachter gar nicht, dass Macht ausgeübt wurde, weil das so kampflos, "unblutig" und vermeintlich konfliktfrei geschieht. Nur die Betroffenen und einige Insider spüren die eiserne Entschlossenheit, die zuweilen hinter der "weichen Schale" durchblitzt. Dennoch sind diese Freundlichkeit und Verbindlichkeit nicht, wie es zuweilen fehlinterpretiert wird, eine Maske, die mühsam die dahinter liegende "stählerne Härte" kaschieren soll, sondern Ausdruck einer wohlwollenden Grundhaltung, die nicht auf Unterwerfung, sondern auf Gestaltung durch Zusammenführung und Integration zielt. |
|
|||
|
Trotzdem knirscht dabei natürlich der eine oder andere Betroffene mit den Zähnen: Auch die sanfteste Form der Machtausübung ändert nichts daran, dass die Betreffenden ursprünglich ganz andere Vorstellungen von der Zukunft hatten und sich nun "mit sanfter Gewalt" auf einen ungeliebten Weg gezwungen sehen. Selbstverständlich macht ihnen dies keine Freude, vielmehr reagieren manche mit mehr oder weniger ausgeprägtem Missvergnügen auf die ungeliebte Richtung. In solchen Fällen wird hinter den Kulissen zuweilen recht ärgerlich und verstimmt über den empfundenen Zwang gesprochen: Bei etwas mitmachen zu müssen, was man eigentlich nicht wollte, macht nun einmal keinen Spaß. Dennoch ist dies, verglichen mit einer persönlichen Demütigung oder einer öffentlichen Niederlage, ein erträgliches Problem. |
|
|||
|
Mit solchem vorübergehenden Unmut muss man leben –und leben können –, wenn man Macht als notwendiges Instrument des Change Management erkennt und sie konsequent zur Durchsetzung von Veränderungen nutzen will. Wer es nicht aushält, dass einige der Betroffenen auch mal verstimmt sind und einen das auch spüren lassen, der sollte sich mit seiner eigenen Konfliktscheu auseinandersetzen. Denn die kann zu einem gefährlichen Hindernis für erfolgreiche Führung und Change Management werden, weil sie einen emotional erpressbar macht. Zwar wäre es natürlich schöner, wenn nicht (mehr oder weniger) sanfter Zwang zum Erfolg führt, sondern echte Überzeugung. Die Frage ist nur, was Sie tun, wenn manche Menschen nicht zu überzeugen sind, weil dem gegenläufige Überzeugungen, Ängste oder Eigeninteressen im Weg stehen. Am Ende bleiben Ihnen dann nur drei Möglichkeiten: Entweder die langwierige Suche nach Kompromissen oder der Verzicht auf das Vorhaben – oder der Mut zur Macht. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||