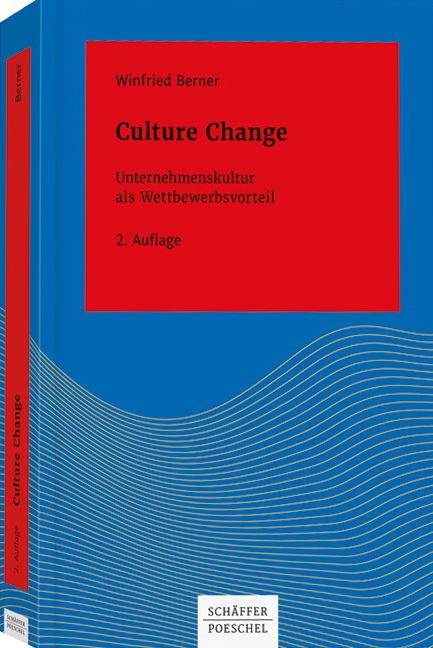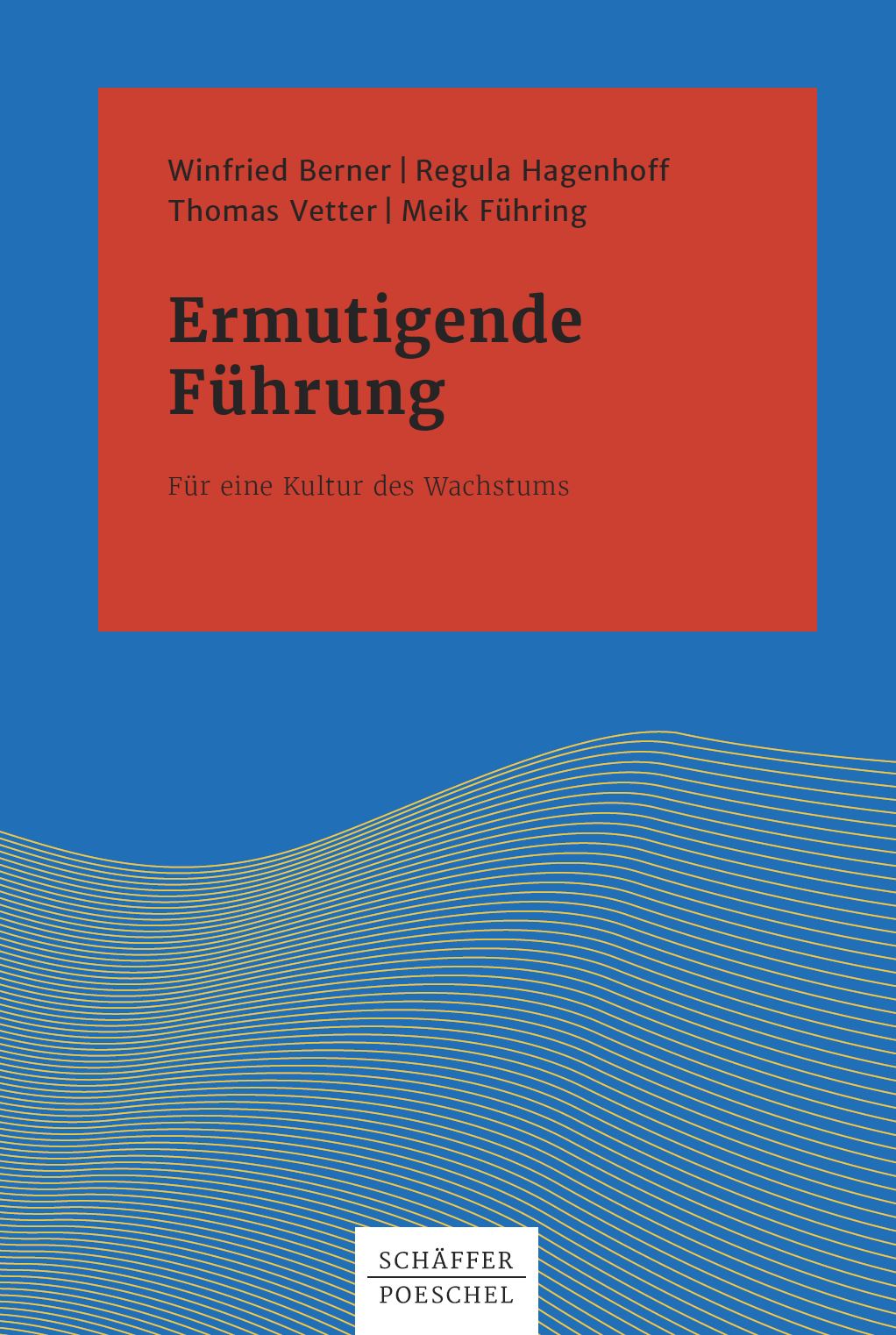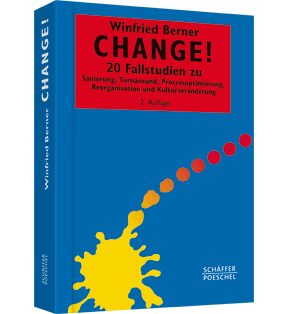Eine Veränderungsstrategie entwickeln
|
||||||||||||||||
Gleichwertigkeit: Das Menschenbild im Change Management |
||
|
Wie wir Veränderungsprozesse angehen und gestalten, hängt sehr viel enger mit unserem Menschenbild zusammen als wir uns normalerweise bewusst machen, sowie mit unseren Vorstellungen darüber, wie soziale Systeme funktionieren. Wer die Menschen im Unternehmen als prinzipiell gutwillig, motiviert und für vernünftige Argumente erreichbar ansieht, wählt andere Vorgehensweisen als jemand, der das Gros der Mitarbeiter als veränderungsunwillig, lethargisch und widerspenstig betrachtet. Und beide kommen mit ihrem Vorgehen an genau den Stellen in Schwierigkeiten, an denen sich das soziale System, mit dem sie es zu tun haben, nicht so verhält, wie es ihrem Welt- und Menschenbild entspricht. |
||
|
Keine dieser Sichtweisen ist absolut falsch. Aber jede von ihnen ist einseitig genug, um mit der daraus resultierenden Konzipierung von Change-Projekten in Schwierigkeiten zu kommen. Je weniger den Verantwortlichen ihr Bild von Menschen und Organisationen bewusst ist, umso mehr fließt es als unreflektierte Prämisse in ihr Handeln ein – und umso überraschender und unerklärlicher sind für sie die auftretenden Probleme. Wer sich Probleme ersparen will, tut gut daher daran, sich bewusst zu machen, mit welchem Menschenbild er an Veränderungsprozesse herangeht – und welches soziale Echo er damit voraussichtlich auslösen wird. Zwar gibt es keine Möglichkeit, objektiv zu bestimmen, was "das richtige" Menschenbild ist; das ist immer zu einem gewissen Teil auch ein "Glaubensbekenntnis". Doch lässt sich sehr wohl sagen, welche Arten, Menschen und soziale Systeme zu betrachten und zu behandeln, sich in der Praxis bewähren und welche in Schwierigkeiten führen. Ja, es lässt sich sogar angeben, in welche Arten von Schwierigkeiten welche Menschenbilder führen. |
|
|
Das soziale Echo unseres eigenen Vorgehens |
||
|
So wie wir die soziale Realität wahrnehmen, so wählen wir auch unsere Vorgehensweisen und Methoden. Hinter jeder Methodenwahl steht, gleich ob uns das bewusst ist oder nicht, eine Annahme darüber, wie die Adressaten auf das jeweilige Vorgehen reagieren werden – und diese Annahme ist unweigerlich von unserem Menschenbild geprägt. Wer Menschen als prinzipiell gutwillig ansieht, erwartet auf ein- und dieselbe Vorgehensweise völlig andere Reaktionen als jemand, der sie als veränderungsunwillig und störrisch betrachtet. Vorgehensweisen, die vor dem Hintergrund des einen Menschenbilds absolut plausibel und schlüssig scheinen, wirken vor dem eines anderen möglicherweise naiv, riskant oder unsinnig, zuweilen geradezu irrwitzig. Der Streit um Vorgehensweisen und Methoden ist implizit nicht selten ein Streit um Menschenbilder. Wenn sich beispielsweise manche Manager und Berater dafür begeistern, die Mitarbeiter mit einer "Bombenwurfstrategie" zu überrumpeln, und andere angesichts solcher Ideen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ist das letztlich kein Methodenstreit, sondern die Kollision von Menschenbildern. |
|
|
|
Aber das ist noch nicht alles. Unterschiedliche Vorgehensweisen, wie sie aufgrund unterschiedlicher Welt- und Menschenbilder gewählt werden, lösen natürlich auch unterschiedliche "soziale Echos" aus. Eine Belegschaft, die mit einem "Bombenwurf" konfrontiert wird, reagiert aufgeregt, aufgebracht und so widerspenstig, wie sie es unter den gegebenen Umständen noch sein kann. Wird die gleiche Belegschaft zu einem partizipativen Prozess eingeladen, reagiert sie völlig anders: Vielleicht abwartend, mit einer Mischung aus Neugier und Skepsis, aber mit Sicherheit sehr viel unaufgeregter. Infolgedessen hinterlässt ein- und dieselbe Belegschaft bei unterschiedlichen Akteure ganz unterschiedliche Eindrücke – und bestätigt sie vermutlich in ihrer Sichtweise. "Ich habe mir gleich gedacht, dass man Veränderungen in diesem Laden nur mit einem Bombenwurf durchsetzen kann", sagen sich dann die einen. "Ich habe mir gleich gedacht, dass man mit den Leuten reden kann, wenn man sie nur vernünftig anspricht", stellen die anderen zufrieden fest. |
|
|
|
Was beide nicht erkennen, ist, dass sie beide hauptsächlich ihr eigenes Echo hören. Im Grunde ist die Reaktion in beiden Fällen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Die Organisation wird ein Stück weit so wie man sie anspricht – gemäß dem Sprichwort: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus." Allerdings reagiert sie nicht so, weil sie "objektiv so ist", sondern weil sie reagiert auf die Art, wie sie angesprochen wurde, und jeweils eine "passende Antwort" darauf gibt. Denn durch die gewählte Vorgehensweise vermitteln die Akteure den Mitarbeitern implizit ja auch ein Bild davon, wie sie sie sehen und wie sie ihr Verhältnis zu ihnen definieren. Und darauf reagieren sie: Freundlich, wenn sie sich angemessen angesprochen fühlen; verstimmt bis ärgerlich, wenn sie sich unangemessen behandelt fühlen, geschmeichelt, aber nicht unbedingt gefügig, wenn sie sich idealisiert sehen. |
|
|
|
Mit diesem Auftakt ist der Ton gesetzt. Damit ist auch vorgeprägt, wie es danach weitergeht – was allerdings nicht zwangsläufig heißt, dass die Fortsetzung der Geschichte den Wunschvorstellungen der Akteure entspricht. Eine Organisation, die einmal mit einer "Bombenwurfstrategie" überrascht wurde, antwortet darauf nicht nur mit erbittertem Widerstand – etwa, indem der Betriebsrat sämtliche Mitbestimmungsrechte ausschöpft und den Arbeitgeber von einer Einigungsstelle in die nächste treibt. Vor allem aber lernt sie daraus für die Zukunft, wird wachsam und misstrauisch, um nicht noch einmal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, und ist ständig auf der Hut, was das Management als nächstes im Schilde führen könnte. Aber auch bei dem partizipativen Ansatz kann von einer Erfolgsgarantie keine Rede sein: Auch wenn sich die Mitarbeiter zunächst auf das Vorgehen einlassen, heißt das noch lange nicht, dass dem eingeschlagenen Weg folgen werden, wohin immer er führt. Oft testen sie bei einem "weicheren" Vorgehen erst einmal aus, wie viel Ernsthaftigkeit und Entschiedenheit von Seiten des Managements wirklich dahinter steckt. |
|
|
Es geht nicht um "Wahrheit", sondern um Brauchbarkeit |
||
|
Bemerkenswert ist, wie stark diese erste Weichenstellung die gesamte Entwicklung prägt: Je nachdem, welche Richtung man ganz am Anfang eingeschlagen hat, nimmt die ganze Sache ihren ganz eigenen Lauf und kommt nie wieder an demselben Punkt an als wenn man am Anfang eine andere Richtung eingeschlagen hätte. Denn in sozialen Prozessen lässt sich nichts rückgängig machen; es geht immer dort weiter, wo man aufgrund der vorausgegangen Schritte angekommen ist. Deshalb ist es auch sehr viel leichter gesagt als getan, falsche Entscheidungen zu korrigieren: Wer mit einer "Bombenwurfstrategie" begonnen hat, macht sich nur lächerlich, wenn er später behauptet, es sei nicht so gemeint gewesen. Denn natürlich war es genau so gemeint, und es ist eine Beleidigung der Intelligenz der Adressaten, dies nachträglich zu dementieren. |
|
|
|
Weil nachträgliche Korrekturen kaum möglich sind, kommt es darauf an, die Weichen von Anfang an richtig zu stellen. Wenn es aber zutrifft, dass die Wahl des Vorgehens eng mit dem Menschenbild zusammenhängt, kommt die Frage nach der richtigen Vorgehensweise beinahe der Frage nach dem richtigen Menschenbild gleich – und nach der richtigen Einschätzung der Ausgangslage. Sofern wir die soziale Realität halbwegs zutreffend wahrnehmen und die zu erwartenden Reaktionen der Betroffenen adäquat einschätzen, wählen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Methoden, die die Situation in die gewünschte Richtung beeinflussen. Wenn wir sie falsch oder tendenziös wahrnehmen, greifen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Methoden, die uns im günstigsten Fall nicht weiterbringen, im ungünstigeren die Situation sogar verschlechtern. Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass uns auch das größte und beste Methodenrepertoire nicht hilft, wenn unsere Wahrnehmung und die dahinter stehenden Bewertungen nicht einigermaßen "realitätstauglich" sind. |
|
|
Streng genommen ist es natürlich verkürzt, von "zutreffender" bzw. von "einseitiger" oder "falscher" Wahrnehmung zu reden – das klingt so, als ließe sich objektiv bestimmen, was wahr und was falsch ist. Spätestens seit Sokrates und Platon wissen wir aber, dass die Wahrheit dem menschlichen Erkenntnisvermögen prinzipiell unzugänglich ist. In diesem Sinne spricht der Konstruktivismus von unterschiedlichen "Realitätskonstruktionen", die gleichberechtigt nebeneinander stehen und von denen keine beanspruchen kann, richtiger als die anderen zu sein, geschweige denn "die einzig Wahre". Wenn also der eine eine bestimmte Situation anders wahrnimmt als der andere, hat aus konstruktivistischer Sicht nicht der eine Recht und der andere Unrecht, sondern beide haben halt unterschiedliche Realitätskonstruktionen, und es ist nicht entscheidbar und nicht einmal sinnvoll zu diskutieren, welche davon "wahr" sei. (Nur den Konstruktivismus halten viele Konstruktivisten für die einzig wahre Realitätskonstruktion.) |
||
|
Aber ganz so beliebig ist es dann doch nicht. Selbst wenn sämtliche möglichen "Realitätskonstruktionen" prinzipiell gleichberechtigt sein mögen, heißt das durchaus nicht, dass alle möglichen Sichtweisen zu gleich guten Ergebnissen führten. Vielmehr gibt es Realitätsdeutungen, die sich als sehr brauchbare Grundlage für unser Handeln erweisen, aber auch solche, die zu schmerzhaften Begegnungen mit der Realität führen – und die wir infolgedessen mit gutem Recht als weniger geeignet oder sogar als unbrauchbar einstufen können. Auch wenn alle denkbaren Sichtweisen prinzipiell "legitim" und "berechtigt" sein mögen, sind darunter doch manche, die als Handlungsorientierung ziemlich ungeeignet sind, weil sie Vorgehensweisen nahelegen und zu Ergebnissen führen, die aus Sicht des Handelnden keinesfalls erwünscht sind, und es gibt andere, die sich als recht brauchbar erweisen. |
|
|
Biographische Verwurzelung unseres Menschenbilds |
||
Das Problem ist nur, dass wir kaum dazu in der Lage sind, unser Menschenbild ernstlich in Frage zu stellen – ja dass wir es in der Regel nicht einmal vollständig kennen. Jeder von uns hat im Laufe seines Lebens bestimmte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht und daraus seine Lehren gezogen. Der Grundstock davon geht auf unsere ersten Lebensjahre zurück; später haben wir unser Bild ergänzt, erweitert und zum Teil auch korrigiert – besonders dann, wenn wir mit einer Realität konfrontiert wurden, die ganz anders war als es unseren Vorstellungen und Erwartungen entsprach. (Was man dann "Praxisschock" nennt.) Im Elternhaus, in der Schule und in der beruflichen Ausbildung haben wir nicht nur Fachwissen erworben, sondern – großteils unbemerkt – auch Welt- und Menschenbilder in uns aufgenommen, die in der jeweiligen Gesellschaftsschicht und Berufsgruppe vorherrschen, wie das vom "homo oeconomicus". Und heute "wissen" wir mit der ganzen Sicherheit unserer gesammelten Lebenserfahrung: "Die Menschen sind ..." (Setzen Sie hier die Eigenschaften ein, die für Sie die Menschen charakterisieren; alle anderen machen es genauso.) |
||
Dieses Welt- und Menschenbild, das jeder Einzelne aus seinen Erfahrungen ableitet, sowie die Schlussfolgerungen, die er daraus für den richtigen Umgang mit anderen Menschen und mit der Lebensrealität gezogen hat, sind unvermeidlich subjektiv: Sie sind geprägt von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, und den Entscheidungen, die wir daraufhin für unser weiteres Leben getroffen haben. Denn natürlich hat jeder in seinem Werdegang andere Erfahrungen gemacht: Gute und schlechte, erfreuliche und schmerzliche, entmutigende und ermutigende … Und selbst wenn die Erfahrungen ähnlich gewesen wären, hätte daraus nicht jeder die gleichen Schlussfolgerungen gezogen: So ist wohl jeder Mensch schon einmal in seinem Leben voll auf die Schnauze gefallen. Aber der eine beschließt darauf: "Nie wieder …", der andere steht auf, putzt sich den Dreck ab und sagt: "Jetzt erst recht!" |
|
|
Der Individualpsychologe Theo Schoenaker hat das einmal in eine sehr einprägsame Metapher gefasst: Das Leben ist wie ein großes Schloss, in das wir mit der Geburt eintreten. Doch kaum sind wir eingetreten, stehen wir vor zwei Türen. Je nachdem, welche wir wählen, geht das Leben weiter. Doch im nächsten Raum stehen wir ebenfalls vor zwei Türen, und im darauffolgenden wieder. Ständig treffen wir Entscheidungen und bestimmen damit nicht nur unseren Lebensweg, sondern auch unser Bild davon, wie das Leben ist. Der eine findet sich irgendwann in einem großen, hellen, schönen Raum und weiß: "So ist das Leben!" Der andere ist in einer finsteren, schäbigen Rumpelkammer angekommen und weiß ebenfalls: "So ist das Leben!" Doch auch diese beiden Räume haben wieder zwei Türen … |
||
Weil sie jeweils von der ganz spezifischen persönlichen Vorgeschichte geprägt ist, ist die Brille, durch die wir die Realität betrachten, zwangsläufig gefärbt: Sie trägt die Tönung all unserer vorausgegangenen Lebenserfahrungen und Entscheidungen, und die sind nun einmal bei jedem Menschen andere. Es liegt also kein Vorwurf und keine Kritik darin, wenn die Individualpsychologie in diesem Zusammenhang von tendenziöser Wahrnehmung spricht: Unser aller Blick auf die Realität ist notwendigerweise und unvermeidlich beeinflusst von unserer Lebensgeschichte. Was zugleich bedeutet: Jeder von uns neigt dazu, bestimmte Themen zu überbetonen und andere kaum zu registrieren, und jeder neigt dazu, auf manche spezifischen Reize, die vorhandene Empfindlichkeiten wachrufen, überreagieren und auf andere kaum anzusprechen. |
|
|
Verteidigung des eigenen Welt- und Menschenbilds |
||
Vor dem Hintergrund dieses unseres Welt- und Menschenbilds beurteilen wir, welche Vorgehensweisen und Methoden uns im Umgang bei Change-Projekten als geeignet erscheinen und welche nicht. Denn wenn die Menschen so sind, wie sie (in unseren Augen) sind, dann ergibt sich daraus ja fast unmittelbar, welche Art(en), sie anzusprechen und mit ihnen umzugehen, sinnvoll sind und welche – aus unserer Sicht – überhaupt keinen Sinn ergibt. Deshalb ist nicht nur unsere gesamte Kommunikation im Change Management, sondern unsere gesamte Beziehungsgestaltung ein direkter oder indirekter Ausfluss unseres Menschenbildes: Ob wir andere um Hilfe bitten oder notorische Einzelkämpfer sind, ob wir unser Herz auf der Zunge tragen oder anderen lieber nicht zu viel Einblick in unsere Gefühlslage geben, ob wir ein "Grundvertrauen" in andere Menschen hegen oder ihr Handeln eher misstrauisch beobachten, all dies und vieles mehr ist Ausfluss davon, wie andere Menschen aus unserer Sicht sind. |
|
|
Wenn wir im Umgang mit anderen Menschen an Grenzen stoßen, sind die meisten Menschen gerne bereit, sich über neue Methoden und andere, mehr Erfolg versprechende Vorgehensweisen informieren zu lassen. Aber es muss viel passieren, bevor wir die grundlegenden Annahmen in Frage stellen, aufgrund derer wir die Methoden ausgewählt haben – zumal sie uns ja nur zum Teil bewusst sind. Denn zum einen meinen wir ja unbezweifelbar und aus unserem tiefsten Inneren zu wissen, dass wir die Welt und die Menschen richtig sehen: Unsere gesamte tausendfach bestätigte Lebenserfahrung zeigt das ja – all die Räume von Schoenakers Schloss, das wir schon durchquert haben, untermauern es. Deshalb ist es zwar leicht, die Subjektivität unseres Welt- und Menschenbilds in der Theorie einzuräumen, aber es erfordert große Reife, sie in der Praxis ernstzunehmen. |
||
Denn es hat ja gravierende Konsequenzen, das eigene Welt- und Menschenbild ernsthaft in Frage zu stellen: Das bringt auf einen Schlag unsere gesamte Orientierung und Handlungssicherheit ins Wanken und ist damit überaus bedrohlich. Wenn die Art, wie wir andere Menschen sehen, falsch oder auch nur ungeeignet sein sollte, wie sollen wir dann wissen, was wir tun sollen?! Und noch mehr: Wenn es wahr wäre, dass ich falsche (einseitige, ungeeignete, untaugliche …) Auffassungen darüber hätte, wie andere Menschen sind und wie sie denken, fühlen und handeln, würde das ja auch all meine Entscheidungen und Handlungen der Vergangenheit in Frage stellen – letztlich mein ganzes bisheriges Leben! Dadurch bekommt die Sache rasch eine Dimension, die atemberaubend und beängstigend wird. Es ist daher allzu naheliegendend, den intellektuellen Notausgang zu nehmen: "Es kann ja nicht alles falsch gewesen sein. Wenn man sieht, wo ich heute stehe, scheine ich ja irgendetwas richtig zu machen!" |
|
|
Weshalb "Tools" nicht helfen |
||
Aus diesem Grund ist die Bereitschaft, sich mit neuen Modellen, Konzepten und Methoden zu befassen, ungleich größer als die, die eigene Wahrnehmung und das dahinter stehende Bild von Menschen und Organisationen zu überprüfen. Das Angebot aller möglichen "Change Tools" stößt daher auf weit größeres Interesse als eine Reflektion des eigenen Menschenbilds. Das Problem ist nur, dass die Erweiterung des Methodenrepertoires bei unveränderter Interpretation der sozialen Realität die Sache nicht besser macht, sondern schlimmer: Wer die Belegschaft eines Unternehmens beispielsweise als prinzipiell veränderungsfeindlich ansieht, wird vor allem nach effizienteren Methoden suchen, sie gegen ihren Willen auf Spur zu bringen – also letztlich nach wirksameren Methoden des Zwanges oder der Manipulation. Wer umgekehrt in naivem Optimismus glaubt, dass Menschen und soziale Systeme automatisch zum Guten streben, wenn man sie nur lässt, wird bei Misserfolgen vor allem nach "noch besseren" Methoden der Selbstorganisation suchen, ohne seine zentrale Prämisse jemals ernstlich in Frage zu stellen. |
||
Bessere "Tools", die auf einem problematischen Menschenbild aufsetzen, machen unser Handeln nicht unbedingt erfolgreicher, vergrößern aber das Risiko, Schaden anzurichten. Und das gerade weil diese neuen Methoden oft durchaus wirksam sind – beispielsweise gibt es ja durchaus effziente Methoden des Zwanges und der Manipulation. Daher kann es durchaus sein, dass manche neuen Tools eine Durchsetzung auch dort noch ermöglichen, wo es mit den alten nicht mehr gegangen wäre. Genau dadurch kann aber bewirken, dass man nur noch ein Stück tiefer in die Sackgasse hineingerät, in der man sich festgefahren hat, wie beispielsweise einen Machtkampf zwischen Management und Belegschaft. (Dieses Phänomen gibt es auch auf anderen Gebieten. So erklärte ein Forstdirektor lakonisch, weshalb die Bayerische Staatsforstverwaltung für ihre Förster keine Allradfahrzeuge – also bessere "Tools" – anschafft: "Dann stecken sie nur noch tiefer im Dreck, dann kriegt man sie überhaupt nicht mehr heraus.") |
||
Trotzdem ist die Sehnsucht nach effizienteren Tools kaum zu überwinden. "Das verstehen wir alles", lautet denn auch die typische Reaktion von Nachwuchs-Führungskräften und Beratern, wenn man die Schlüsselrolle des Menschenbilds erläutert hat, "aber hätten Sie nicht trotzdem ein paar gute Tools für uns?" Was im günstigsten Fall wohl so viel heißt wie: Im Grundsatz leuchtet mir ja ein, dass ein einseitiges oder verzerrtes Menschenbild einen im Change Management in größte Schwierigkeiten bringen kann. Aber mich betrifft das ja nicht: Mein Menschenbild ist ja richtig, das hat sich ja tausendfach bestätigt. Was ich daher brauche, sind vor allem wirksamere Tools … – Im Grunde unterstreichen diese Reaktionen nur, dass Menschen kaum fähig und noch weniger willig sind, ihr Weltbild in Frage zu stellen. Und dennoch wäre es ein Irrtum, die Unerschütterlich der eigenen Überzeugung für einem Wahrheitsbeweis zu halten. |
||
Letztlich besteht die Gefahr, sich auf diese Weise in einen "Rüstungswettlauf" zu verstricken: Während das Management und seine Berater nach immer effizienten Techniken der Steuerung und Manipulation suchen, entwickeln Mitarbeiter und Betriebsrat immer wirksamere Mitteln und Methoden der Abwehr. Dabei bestätigen sich beide gegenseitig in ihrer Überzeugung, dass man vor der anderen Seite auf der Hut sein muss und noch bessere Tools und Instrumente braucht, um trotzdem etwas voranzubringen – bzw. nicht über den Tisch gezogen zu werden. |
|
|
Je nach eigenem Menschenbild wird man diesen Rüstungswettlauf zwar nicht bestreiten, aber unterschiedlich beurteilen. Während den einen dessen Absurdität ins Auge springt, werden andere einräumen, dass solch ein permanenter Machtkampf zwar nicht effizient ist, aber leider nicht zu vermeiden sei – jedenfalls nicht "mit diesem Management" bzw. "nicht mit diesem Betriebsrat". Das mag im Einzelfall stimmen oder auch nicht – es hat keinen Sinn, darüber zu streiten, denn dadurch ändern sich Weltbilder nicht: Jeder "weiß" ja "aufgrund all seiner Lebenserfahrung", wie die Menschen sind, und darin lässt er sich durch andere Sichtweisen und Argumente nicht irremachen: So ist das Leben ... |
||
Reibungsverluste durch Machtkämpfe |
||
|
Doch unterschiedliche "Realitätskonstruktionen" mögen gleich berechtigt sein, gleich "praktisch" sind sie nicht. In einer Wettbewerbswirtschaft sind Sichtweisen, die zu erhöhten Reibungsverlusten und damit Ineffizienzen führen, ein Wettbewerbsnachteil, der umso gravierender wird, je vergleichbarer die Produkte oder Dienstleistungen ansonsten sind. Wenn die Konkurrenz es schafft, Veränderungen effizienter und mit weniger Reibungsverlusten zu realisieren, dann sind erstens ihre ökonomischen und sozialen Kosten pro Veränderungsprozess niedriger. Zweitens haben sie dann die Chance, dank ihrer höheren Veränderungsfähigkeit und schnelleren Veränderungsgeschwindigkeit über die Zeit einen erheblichen Vorsprung vor jenem Unternehmen aufzubauen, das sich jeden Fortschritt erst über mühsame Machtkämpfe erarbeiten muss. |
|
|
Das ist deshalb so entscheidend, weil es gerade solche Machtkämpfe sind, die viele Change-Prozesse an die Grenze des Scheiterns oder darüber hinaus bringen. Sie kosten nicht nur viel Zeit und verschleißen ungeheuer viel Energie, sondern bewirken auch, dass Veränderungen nur halbherzig, unvollständig oder sinnwidrig umgesetzt werden, dass faule Kompromisse geschlossen, offizielle oder inoffizielle Ausnahmen zugelassen und Abstiche an den eigenen Zielen gemacht werden müssen, etwa, weil der Betriebsrat unter Ausnutzung seiner Mitbestimmungsrechte Einschränkungen erzwingt oder weil sich einflussreiche "Platzhirsche" in ihrem Beritt nicht an die gesetzten Regeln halten. Vor allem aber hinterlassen Machtkämpfe ihre Spuren in den innerbetrieblichen Beziehungen und machen Unternehmen im Laufe der Zeit immer schwergängiger, weil man nicht mehr unbefangen und sachbezogen miteinander umgeht, sondern sich gegenseitig belauert, immer mit dem Misstrauen, was die andere Seite schon wieder beabsichtigt, und die eigenen Bataillone vorsorglich dagegen in Stellung bringt. |
||
|
Auch wenn sie ähnliche Ursprünge haben, gehen solche Machtkämpfe deutlich über jene Widerstände hinaus, die zu jedem Veränderungsprozess gehören: Zwar entstehen beide zumeist aus Ängsten oder aus Reaktanz, also der Abwehr von fremden Eingriffen in den eigenen Handlungsspielraum. Doch während Widerstände vor allem auf die (individuelle oder kollektive) Bewältigung oder Abwehr der "drohenden" Veränderungen zielen, stellt der Machtkampf eine Zuspitzung und zugleich eine Polarisierung dar: Jetzt geht es darum, sich den vom Management geforderten Veränderungen nicht unterwerfen zu müssen. Auf der anderen Seite bemühen sich das Management und seine Helfer nach Kräften, diese Veränderungen gegen den Widerstand durchzusetzen: Diese offene oder verdeckte Konfrontation ist es, was mit "Machtkampf" gemeint ist. |
|
|
|
Während normale Veränderungswiderstände eine spontane emotionale Reaktion auf von anderen ausgelöste Veränderungen sind, folgen Machtkämpfe einer anderen Logik. Denn sich auf einen Machtkampf einzulassen, ergibt nur unter zwei Voraussetzungen Sinn: Erstens, dass es – aus der eigenen subjektiven Sicht – gute Gründe gibt, sich den geforderten Veränderungen zu verweigern, zweitens, dass es Aussicht auf Erfolg hat, dies zu tun. Wenn auch nur eine dieser Voraussetzungen entfällt, entwickelt sich kein Machtkampf: Wenn es keinen Grund zur Gegenwehr gibt, liegt dies auf der Hand – aber auch wenn Widerstand zwecklos erscheint, hat es wenig Sinn, einen Machtkampf anzuzetteln, weil man sich damit nur eine sichere Niederlage abholen würde. Das ist der Grund, weshalb es beispielsweise gegen Fusionen, Übernahmen und Sanierungen relativ wenig (internen) Widerstand gibt: Es scheint schlicht aussichtslos, sich dagegen zu wehren. |
|
|
Die eine Möglichkeit: Machtkämpfen keine Chance lassen |
||
|
Wenn man das ernst nimmt, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, Machtkämpfe zu verhindern: Zum einen, dafür Sorge zu tragen, dass die Betroffenen keinen Grund sehen, eine Auseinandersetzung anzuzetteln, zum anderen, dafür zu sorgen, dass sie jeden Widerstand für aussichtslos halten und deshalb auf Gegenwehr verzichten. Auf den ersten Blick erscheint die zweite Variante leichter durchführbar, deshalb versuchen politische Diktaturen regelmäßig, die Bevölkerung durch ein brachiales Vorgehen und unnachgiebige Unterdrückung jeglichen Widerstands davon zu überzeugen, dass Gehorsam und Unterwerfung "alternativlos" sind. Doch die politische Erfahrung scheint zu signalisieren, dass selbst brutalste Unterdrückung selten auf Dauer funktioniert. |
|
|
Bei der Übertragung dieser Erfahrungen auf Unternehmen muss man einige wichtige Unterschiede berücksichtigen: Nicht nur, dass Unternehmensleitungen keine so unumschränkten Möglichkeiten zur Machtausübung haben wie Diktaturen (was niemand ernstlich bedauern wird), sondern auch, dass die wenigsten Mitarbeiter und Führungskräfte zu ihrem Unternehmen eine so enge und unauflösliche Beziehung haben wie zu ihrem Heimatland. Infolgedessen ist auch die Wahrscheinlichkeit von "Freiheitskämpfen" deutlich geringer: Wer mit dem Stil, wie "sein" Unternehmen geführt wird, nicht einverstanden ist, braucht keine Befreiungsbewegung gründen, es reicht, sich einen anderen Job zu suchen; das ist mit wesentlich weniger gesundheitlichen und anderen Risiken verbunden. |
||
|
Aus diesen Gründen ist in Unternehmen sehr viel weniger an Zwang und Repression erforderlich, um Machtkämpfe aussichtslos erscheinen zu lassen: In den meisten Fällen genügt es, wenn die Geschäftsleitung die Mitarbeiter und Führungskräfte davon überzeugt, dass sie felsenfest entschlossen ist, die Veränderungen durchzusetzen, und dafür nötigen Preis bezahlen und auch die nötige Beharrlichkeit aufbringen wird. Wenn diese Ansage glaubwürdig ist, was wiederum von der Vorgeschichte dieses Unternehmens und vor allem von den bisherigen Erfahrungen der Mitarbeiter mit dieser Geschäftsleitung abhängt, stehen Mitarbeiter, Führungskräfte und Betriebsrat vor der Frage, ob es ihnen lohnend erscheint, sich trotzdem auf einen Machtkampf einzulassen, oder ob sie sich lieber in ihr Schicksal fügen. |
|
|
|
Allerdings stehen im Gegenzug die Führungskräfte und Mitarbeiter vor der Wahl, ob sie sich diesen Forderungen unterwerfen wollen oder ob sie von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen, sich nach einer anderen Beschäftigung umzusehen. Wie sie sich entscheiden, ist nicht nur eine Frage der Inhalte der Veränderungen; vielmehr ist es zu einem guten Teil auch der Ton, der die Musik macht. Es ist ein Unterschied, ob die Geschäftsleitung in freundlicher, aber fester Weise deutlich macht, dass bestimmte Veränderungen nicht verhandelbar sind, oder ob sie dies in arroganter, aggressiv-drohender oder herabsetzender Weise tut. Es ist ein Unterschied, ob sie erläutert, aus welchen Gründen sie auf bestimmten Veränderungen insistiert, oder ob sie unhinterfragten Gehorsam verlangt. Und es ist ein Unterschied, ob sie nur die Ziele vorgibt, aber Freiräume für die Art ihrer Umsetzung gibt, oder ob sie erzwingt, dass die Dinge exakt nach ihren Vorstellungen (oder denen ihrer Berater) umgesetzt werden. |
||
Wobei die Art des Vorgehens und der Kommunikation natürlich kein Zufall ist, sondern auch wieder Ausfluss des Welt- und Menschenbilds: Wer die Mitarbeiter und Führungskräfte als Menschen achtet und ihnen in partnerschaftlicher Weise begegnen will, für den liegt es nahe, ihnen die Veränderungen zu erläutern, ihnen deren Unabhänderlichkeit auf freundliche, wenn auch unmissverständliche Weise deutlich zu machen und ihnen bei der Ausgestaltung Freiräume zu lassen, wo immer dies ohne Verwässerung der Ziele möglich ist. Wer ihnen dagegen misstraut, für den ist es durchaus naheliegend, sie die eigene Macht spüren zu lassen und ihnen für den Fall des Ungehorsams mit drastischen Konsequenzen zu drohen. |
||
Die andere Möglichkeit: Keine Gründe für Machtkämpfe geben |
||
Der andere Ansatz, Machtkämpfe zu vermeiden, ist, keinen Anlass dafür zu liefern. Auf der inhaltlichen Seite ist das nicht immer möglich, denn wenn die Veränderungen für bestimmte Personen oder Gruppierungen "ans Eingemachte gehen", können sie immer versucht sein, diese Veränderungen durch einen Machtkampf abzuwenden. Doch in der Mehrzahl der Fälle entstehen Machtkämpfe nicht – oder nicht allein – aus den Inhalten der Veränderung, sondern auch und vor allem als Reaktion auf die Art des Vorgehens. Mit anderen Worten, oft steht dahinter nicht primär ein Sach- oder Interessenkonflikt, sondern ein Beziehungskonflikt: Manche beteiligten Personen oder Parteien sind nicht einverstanden mit der Art, wie sie behandelt werden, oder mit der Rolle, die ihnen bei dem Change-Vorhaben zugewiesen wird, und gehen deshalb in den Widerstand. |
|
|
Dann rebellieren sie gegen ihre Behandlung oder gegen die ihnen zugewiesene Rolle – auch wenn sie vordergründig mit Sachargumenten gegen die Inhalte der Veränderung angehen. Aber davon darf man sich nicht täuschen lassen: Wie sollten sie ihren Widerstand auch sonst begründen? In unserer herrschenden Businesskultur können sie ja schlecht vorbringen, dass sie persönlich beleidigt, verärgert oder empört darüber sind, wie sie behandelt wurden, und die Veränderungen jetzt torpedieren, um zu zeigen, dass sie sich das nicht gefallen lassen. Wer so unklug wäre, so ehrlich zu sein, würde sich dem Vorwurf aussetzen, sich "unsachlich" und emotional zu verhalten – und dann stünde er erst recht dumm da. Um einem solchen Ordnungsruf zu entgehen, verstecken sie ihr legitimes Bedürfnis nach Respekt und angemessener Behandlung hinter Pseudo-Sachargumenten. Aber natürlich ist solch ein Konflikt nicht durch "Versachlichung" zu lösen – im Gegenteil: Er wird durch Versachlichung erst recht unlösbar. |
||
Auch in solchen Fällen ist die Wahl des Vorgehens Ausfluss eines Welt- und Menschenbildes: Durch ihr Vorgehen verraten die handelnden Personen mehr darüber, wie sie über die Menschen auf den unteren und mittleren Etagen der Hierarchie denken, als sie vermutlich verraten wollten. Und die Abwehrreaktion der Betroffenen zeigt, dass sie die Botschaft verstanden haben: Sie verwahren sich auf ihre Art dagegen, wie sie gesehen und behandelt werden. |
||
Das Echo unserer Vorgeschichte – und unseres Menschenbilds |
||
Zuweilen aber hat der aktuelle offene oder verdeckte Machtkampf gar nicht mit dem gegenwärtigen Projekt zu tun, sondern mit dem Begleichen offener Rechnungen aus früheren Begegnungen: Manchmal legt sich jemand einfach deshalb quer, weil er sich für eine zurückliegende Kränkung rächen will, dem Verantwortlichen den Erfolg seines Vorhabens nicht gönnt und/oder ihn "vorführen", sprich demütigen möchte. Denn wie die Umgebung auf ein neues Vorhaben reagiert, hängt nicht nur von diesem Vorhaben selbst ab, sondern auch von der Vorgeschichte, von den "Altlasten" aus zurückliegenden und ungeklärten Beziehungskonflikten sowie von dem persönlichen Ansehen seines Initiators. Der Extremfall sind Manager, die eine so lange Schleppe zwischenmenschlicher Altlasten hinter sich herziehen, dass sie kaum noch etwas Positives bewirken können. Manche wechseln denn auch die Firma, wenn ihre Schleppe zu lang und schwer geworden ist, und fangen anderswo (fast) neu an – aber natürlich auf Basis desselben Welt- und Menschenbildes. |
||
Zwar kann man, wenn man gerissen und skrupellos genug ist, einem Bauern eine Melkmaschine verkaufen und dafür dessen einzige Kuh in Zahlung nehmen. Aber man braucht sehr viele neue Kunden, wenn man auf dieser Basis langfristig im Geschäft bleiben will, und diese Kunden sollten sich möglichst nicht kennen, damit sie ihre Erfahrungen nicht austauschen. Wenn einem erst einmal der Ruf vorausgeht, link zu sein und andere Menschen nur zu benutzen, ohne Rücksicht auf deren Belange und Interessen, werden die Leute vorsichtiger: Mit so jemandem macht man lieber keine Geschäfte. Innerhalb von Unternehmen heißt das nicht unbedingt, dass die Leute gar nicht mehr mitspielen, denn auch solche Manager haben ja weiter Einfluss auf Karrieren, Belohnungen und Sanktionen. Aber die Menschen werden ihrerseits taktischer und berechnender: An die Stelle des Engagements für die Sache tritt die Kalkulation des eigenen Vorteils, was natürlich das Klima der Zusammenarbeit von Grund auf verändert. |
||
Wer mit anderen Menschen erfolgreich zusammenarbeiten möchte – gleich ob aus einer gleichgestellten oder einer hierarchisch höheren Position –, muss mit ihnen so umgehen, dass sie nicht vor ihm auf der Hut sein müssen. Und er muss mit ihnen auch in der Vergangenheit so umgegangen sein, denn niemand würde darauf vertrauen, dass er jemanden bei dem aktuellen Thema als verlässlichen Partner ansehen kann, wenn das in der Vergangenheit zuweilen anders war. Es ist tatsächlich so: Ein guter Ruf ist langsam aufgebaut, aber schnell zerstört. Manchmal reicht ein einziger Fehlgriff, damit die Leute sagen: "Jetzt hat er sein wahres Gesicht gezeigt!" |
||
Gleichwertigkeit statt Hierarchisierung |
||
Neben der persönlichen Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit ist ein zweiter Aspekt von Bedeutung, nämlich, ob alle Beteiligten und Betroffenen als gleichwertige Partner betrachtet und behandelt werden. Viele Manager und Berater haben, oft ohne dass ihnen das selbst bewusst ist, einen Blick auf Veränderungsprozesse, der dem von Wissenschaftlern auf ihre Versuchtstiere ähnelt: Stillschweigend unterscheiden sie zwischen ihresgleichen, den "intelligenten und engagierten Machern", die Veränderungen zum Besten des Unternehmens voranbringen wollen, und der breiten, dumpfen Masse, die in erster Linie an sich selbst denkt, im Status Quo verhaftet ist und jeglicher Veränderung ablehnt – und die man daher irgendwie beruhigen, beschwichtigen und für die vorgesehenen Veränderungen "motivieren" muss. |
||
Sichtbar wird das daran, wie bei den "Machern" über die Denkweise und die Motivation der Adressaten gesprochen wird. Ein Warnsignal ist immer, wenn das eigene Denkmodell implizit eine Über- und Unterordnung enthält und man die "Theorien", die man in Bezug auf Mitarbeiter und mittlere Führungskräfte pflegt, niemals auf sich selbst anwenden würde: Der Forscher, der in seinem Labor die Konditionierung untersucht, würde sein eigenes Handeln als Forscher vermutlich kaum als konditioniertes Verhalten erklären. |
||
Solche impliziten Denkmodelle sind teils paternalistisch-wohlwollend, so wie Pfarrer früher über ihre "Schäflein" gedacht haben mögen oder Familien-Patriarchen über "meine Betriebsfamilie", teils feindselig-entwertend, wie McGregors berühmte "Theorie X", die das Gros der Mitarbeiter als dumm, faul und gefräßig ansieht, sodass es nur durch harte Zucht und Kontrolle dazu zu bringen ist, während der bezahlten Arbeitszeit etwas zu leisten. Doch selbst in der wohlwollenden Variante werden die Betreffenden nicht für voll genommen; vielmehr streben die jeweiligen "Oberhirten" in überlegener und beschützender Weise danach, sie – notfalls auch gegen ihren Willen – mit sanfter Hand zu ihrem eigenen Besten zu führen. |
||
Diese Hierarchisierung der Beziehung in Lenker und Gelenkte mag in früheren Zeiten funktioniert haben, doch in den letzten Jahrzehnten hat sie immer mehr an Akzeptanz verloren. Schon 1968 hat der Individualpsychologe und Psychiater Prof. Rudolf Dreikurs (1897 - 1972) festgestellt, dass es in einem demokratischen Zeitalter nicht mehr möglich ist, autoritär zu erziehen und autoritär führen. Im Zuge der Demokratisierung ist schlicht die Legitimation dafür verloren gegangen, private wie gesellschaftliche Beziehungen auf Über- und Unterordnung aufzubauen: Das wird heute von denen, denen eine untergeordnete Position zugewiesen werden soll, nicht mehr akzeptiert; sie lehnen sich dagegen auf. Der Versuch, dennoch die alte (Über-)Ordnung zu erzwingen, führt laut Dreikurs unweigerlich dazu, dass sich sowohl Individuen wie gesellschaftliche Gruppen in ebenso unproduktiven wie aufreibenden Machtkämpfen verstricken: Machtkämpfe zwischen Ehepartnern, zwischen Frauen und Männern, Eltern und Kindern, Schülern und Lehrern, Vorgesetzten und Mitarbeitern, Gewerkschaften und Arbeitgebern, aber auch zwischen ganzen Weltregionen. |
||
Was Gleichwertigkeit bedeutet (und was nicht) |
||
Den einzigen Ausweg aus diesen destruktiven Machtkämpfen sieht Dreikurs darin, soziale Beziehungen prinzipiell auf der Basis von Gleichwertigkeit zu gestalten: Als respektvolle, gleichberechtigte Beziehungen, die vorhandene Unterschiede weder leugnen noch ignorieren, auch eigene Überzeugungen und Bedürfnisse nicht zur Disposition zu stellen, aber bei aller Unterschiedlichkeit einen Konsens statt bloßen Gehorsams anstreben. Das war vor 50 Jahren ein kühner und visionärer Gedanke, der auch heute noch manchem Unbehagen bereiten mag. Doch Dreikurs hat ein kaum widerlegbares Argument auf seiner Seite, nämlich, dass autoritäre Strukturen in den allermeisten Lebensbereichen schlicht nicht mehr akzeptiert werden. Die Frage ist daher nicht, ob uns das gefällt oder ob es uns lieber wäre, wenn die Leute einfach täten, was man ihnen sagt – der Punkt ist, dass wir heute keinen unhinterfragten Gehorsam mehr erwarten können und dass wir gut daran tun, ihn auch nicht erzwingen zu wollen. |
||
Umso wichtiger ist, Klarheit darüber zu gewinnen, was dieses Prinzip der Gleichwertigkeit eigentlich bedeutet – und auch, was es nicht bedeutet. Gleichwertigkeit heißt weder Gleichheit noch Gleichberechtigung: Ganz offensichtlich sind die Menschen nicht gleich, sondern sehr verschieden. Und zumindest innerhalb eines Unternehmens sind sie auch nicht gleichberechtigt, sondern haben unterschiedliche Rollen und Funktionen und deshalb auch unterschiedliche Rechte und Befugnisse. Aber das berechtigt niemanden, sich über die Anderen zu stellen: Wer eine konstruktive Zusammenarbeit anstrebt und unnötige Konflikte vermeiden will, muss zu einem Dialog "auf gleicher Augenhöhe" bereit sein. Diese in den letzten Jahren so populär gewordene Formulierung bringt ja nichts anderes zum Ausdruck als den Anspruch auf ein offenes Gespräch, bei dem sich keiner über den anderen stellt – mit anderen Worten, einen Anspruch auf Gleichwertigkeit. |
||
Gleichwertigkeit heißt nicht, dass Veränderungen nur noch im Konsens möglich sind – was im Umkehrschluss ja hieße, dass jeder einzelne Mitarbeiter ein Vetorecht gegen jedwede Veränderung hätte, was wiederum faktisch auf weitgehende Handlungsunfähigkeit hinausliefe. Die letzte Entscheidung liegt beim Management, aber sie muss nachvollziehbar gemacht werden und sich dem kritischen Dialog stellen. Und das Management sollte bereit sein, seine Entscheidungen zu korrigieren oder zu modifizieren, wenn dieser Dialog schlüssige Gründe dafür erbringt. Der beste Weg, Gleichwertigkeit in die Praxis umzusetzen, ist aber, nicht zuerst im Management Entscheidungen zu treffen und sie dann zur Diskussion zu stellen, sondern, Ziele und vor allem den Weg zu ihrer Realisierung unter Einbeziehung möglichst aller Betroffenen zu entwickeln. Das Management hat dennoch das Recht und auch die Pflicht zur Entscheidung – die Kunst ist, den Prozess so zu gestalten, dass diese Entscheidung in der Mehrzahl der Fälle aus der Zustimmung zu einer sinnvollen und überzeugenden Lösung besteht. |
||
Ob ein Menschenbild, das in diesem Sinne auf Gleichwertigkeit basiert, "richtiger" ist als andere Menschenbilder, lässt sich weder prüfen noch beweisen. Empirisch untermauern lässt sich aber, dass dieses Menschenbild für das Change Management zweckmäßig ist, weil es zu besseren Ergebnissen und zu weniger Reibungsverlusten führt als andere Arten, Menschen und soziale Systeme zu betrachten und zu behandeln. Wobei es auch hier zu kurz gegriffen wäre, die Einbeziehung nur als "effizientes Tool" zu verstehen: Wer sie als Manipulationstechnik nutzt, um seine Schäflein effizient zu lenken, mag damit ein paar Mal durchkommen, doch er wird früher oder später durchschaut werden und dann das Vertrauen "nachhaltig" verlieren. Gleichwertigkeit muss das Denken – und damit auch das Reden in Abwesenheit der Betroffenen – prägen; dann ist deren Einbeziehung ebenso die logische Folge wie ein "Dialog auf gleicher Augenhöhe". |
||
Literatur: |
||
|
||
|
||
|